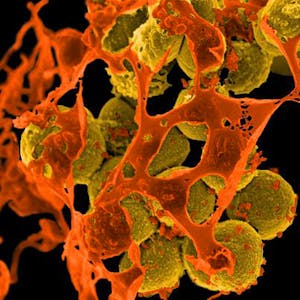Corona-KriseKünstler waren schon immer von Katastrophen fasziniert

Théodore Géricaults „Floß der Medusa“
Copyright: Foto: Wikicommons/Louvre
- Schon immer haben Katastrophen die Künstler fasziniert. Auf ihren Bildern suchen sie nach einem Sinn im unendlichen Leid.
- Die christliche Kunstgeschichte ist voller Katastrophen. Sie beginnt mit dem Sündenfall und hört bei der Sintflut noch lange nicht auf.
- Heute lassen sich Katastrophen meist wissenschaftlich erklären. Aber das macht sie nicht weniger verstörend.
Köln – War im Anfang das Wort – oder doch die Katastrophe? Seit dem Urknall dehnt sich das Universum aus, und zwar nach Gesetzen, die wir schon deswegen nicht beherrschen können, weil wir sie nur unzureichend verstehen. Mit der explosiven Schöpfung scheinen Chaos und irdische Desaster programmiert, weshalb wir, wenn wir im Fernsehsessel von einem Unglücksort zum anderen reisen, möglicherweise das kosmische Hintergrundrauschen unserer Existenz betrachten.
In der christlichen Bildgeschichte der Welt sorgt hingegen ein liebender und strafender Gott für Ordnung. Die Schöpfung beschert Adam und Eva paradiesische Zustände ohne Erdbeben oder Pandemien, und auch die biblische Urkatastrophe, der Sündenfall, schlängelt sich eher unspektakulär heran. Bei Albrecht Dürer bleiben Adam und Eva selbst dann noch Idealmenschen, wenn sie in den verhängnisvollen Apfel beißen, und auf Michelangelos „Vertreibung aus dem Paradies“ ziehen sie davon wie Kinder, die zwar wissen, dass sie gesündigt haben, aber die Strafe im tiefsten Herzen nicht verstehen. Wie könnten sie auch begreifen, dass sie aus dem Zustand der Unschuld gefallen sind, wenn sie nichts anderes kennen?
Das könnte Sie auch interessieren:
Auf diese Gnade können sich die Nachgeborenen nicht mehr berufen, weshalb biblische Katastrophen zum festen Programm der europäischen Kunstgeschichte gehören. Mit Sodom und Gomorra gehen ganze Städte unter, wenn auch nicht zwangsläufig vor unseren Augen; Peter Paul Rubens zeigt lieber, wie ein Engel Lots Familie rechtzeitig aus der Stadt führt, um die Betrachter vor einem möglichen Weiterleben als Salzsäule zu bewahren. Grausige Details erspart uns auch Jan Brueghel der Ältere auf seinem Gemälde der Sintflut: Gottes letzter Versuch, seine missratene Schöpfung durch Drücken des Reset-Knopfes zu bessern, könnte hier beinahe idyllisch wirken, triebe im Hintergrund nicht die Arche Noah auf den Fluten. Die Stunde der detailverliebten Martermaler schlägt hingegen in den Bildern der Apokalypse, der ultimativen christlichen Katastrophe.
Göttliches Strafgericht
Freilich hat die Idee der Katastrophe als göttliches Strafgericht (für alle Ewigkeit oder für Zwischendurch) spätestens in der Moderne an Überzeugungskraft verloren. Naturkatastrophen oder Epidemien ziehen uns deswegen aber nicht weniger in den Bann, zumal seitdem wir wissen, dass sie nicht unbedingt schicksalsgleich über uns kommen. Viele Deutungsversuche von Katastrophen schreiben zudem alte christliche Vorstellungen fort. Romantische Revolutionäre sehen in ihnen die Möglichkeit einer Reinigung, durch die Neues erst entstehen kann, moralisch Entrüstete das Menetekel menschlicher Anmaßung, Pragmatiker etwas, dessen Erinnerung unser Handeln lenken soll. Auch darin liegt die Dialektik der Aufklärung: Dass sich Katastrophen wissenschaftlich erklären lassen, macht sie nicht weniger verstörend.
In der Kunst hat auch die säkularisierte Faszination für die Katastrophe weiten Nachhall gefunden. Am berühmtesten ist Théodore Géricaults „Floß der Medusa“, dessen allegorische Darstellung einer Menschheit, die dicht gedrängt zwischen Hoffnung und Verderben auf einem Meer voller Gefahren treibt, zum kollektiven Bildgedächtnis gehört. Wie solche Sinnstiftungen inszeniert werden, welchen Konjunkturen sie unterliegen und wessen Interessen sie bedienen, sagt viel über die gesellschaftlichen Verhältnisse aus, in denen sie entstehen. So erzählen zahlreiche Metaphern, die in den 1990er Jahren um die Krankheit Aids gesponnen werden, außer von Homophobie vor allem von der Verdrängung des Todes aus unserem Alltagsleben.
Optischer Phantomschmerz
Soziale Katastrophen wie Kriege oder Epidemien, deren Ausmaße sich mangels eines visuell fassbaren Epizentrums der Darstellung entziehen, sind gleichsam unsichtbar. Selbst Goyas Grafiken von den „Desastern des Krieges“, so schockierend sie in ihrer Konkretheit sind, erzeugen beim Betrachter lediglich einen optischen Phantomschmerz. Aus diesem Bewusstsein heraus zeigt etwa Christoph Draeger in seiner Fotoserie „Voyages apocalyptiques“ Orte von Katastrophen, nachdem die Spuren der Zerstörung aus ihnen verschwunden sind. Eine gleichgültige Ruhe liegt über den Aufnahmen von Rammstein, Little Bighorn oder Hiroshima, bis die Erinnerung, ausgelöst durch Chiffren gewordene Ortsnamen, in die unscheinbaren Szenen einsickert.
Ähnliches gilt für schleichende Katastrophen wie den Klimawandel; man ahnt, dass es bereits zu spät sein könnte, wenn die bleibenden Bilder gefunden sind. Vielleicht kraxelt Julian Charrière deswegen mit dem Schweißbrenner auf einem haushohen Eisberg herum, um ihn schneller zum Schmelzen zu bringen. Auf den historischen Luftaufnahmen, die Olafur Eliasson für seine „Cartographic Series“ in beinahe abstrakte Bilder von Gebirgszügen, Flüssen oder Gletschern verwandelt, scheint die Welt hingegen noch in Ordnung. Gelegentlich stört der Mensch aber auch hier den Formwillen der Natur.
Menschenleere Plätze
Und welche Bilder werden eines Tages für Corona stehen? Im Moment geht der Blick noch zurück in die Kunstgeschichte, zu Edward Hoppers intimen Panoramen der Vereinsamung oder den Darstellungen der schwarzen Pest. Von gespenstischer Aktualität sind die vor dem Ersten Weltkrieg entstandenen „metaphysischen“ Italienbilder Giorgio de Chiricos. Sie zeigen Häuser, Straßen und Plätze einer sich selbst genügenden Idealarchitektur, kein Mensch ist da, um sie zu bewundern. So wie diese steinerne Welt in der tiefen Sonne steht, traumhaft und für die Ewigkeit geschaffen, wird es sie noch geben, wenn wir schon lange nicht mehr sind.