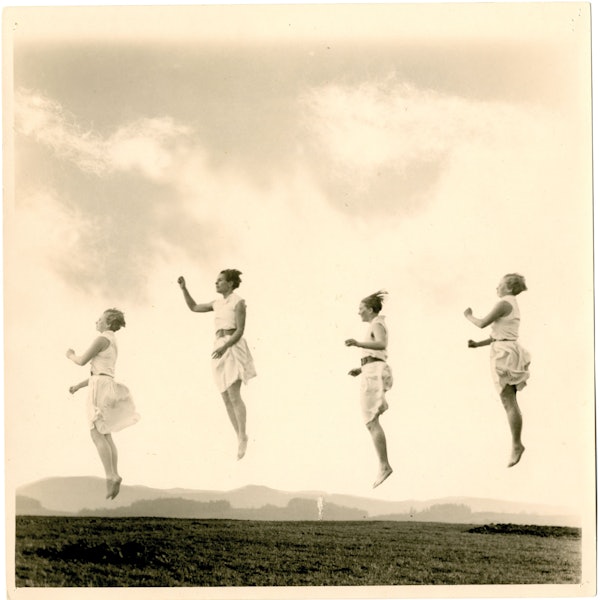Die Bundeskunsthalle erhebt den Filmemacher zum 80. Geburtstag zum Staatskünstler. Aber das ist ein großes Missverständnis.
BundeskunsthalleWomit hat Wim Wenders das verdient?

Bruno Ganz in „Der Himmel über Berlin“ von Wim Wenders
Copyright: Road Movies, Argos Films, Wenders-Stiftung
Stellen Sie sich vor, Sie erwachen in der Nacht und finden sich in einer riesigen Bilderhöhle wieder. Eine acht Meter hohe Nastassja Kinski blickt von allen Seiten auf Sie herab und dann vielleicht ein grauer Engel aus dem Himmel über Berlin. Allmählich dämmert Ihnen, dass Sie in einer Endlosschleife aus Wim-Wenders-Filmen gefangen sind, musikalisch unterlegt von Ry Cooder, Nick Cave, U2 und Canned Heat. Stellen Sie sich vor, dies wäre ein Traum, und entscheiden Sie selbst, ob Sie sich wohlig auf die andere Seite drehen oder es höchste Zeit finden, schreiend zu erwachen.
In der Bonner Bundeskunsthalle lässt sich diese Traum-/Alptraumkammer nun im Wachzustand besichtigen – in ihrer trivialen oder, je nach Sichtweise, entschärften Version einer „immersiven“ Rauminstallation. Früher hätte man den mit vier riesigen Leinwänden ausstaffierten Museumssaal wohl schlicht Rundkino genannt, auch wenn sich Wenders mit dem peripheren Sehen in der von ihm selbst entworfenen Bilderwelt nicht zufriedengibt. Die Ausschnitte aus „Paris, Texas“, „Der Himmel über Berlin“, „Bis ans Ende der Welt“ und einem „Best of“ schließen die Besucher ein, was allerdings noch beeindruckender wäre, hätte man Augen im Hinterkopf.
Seinen Platz in der Filmgeschichte hat Wim Wenders sicher
Nastassja Kinski als vervierfachtes Monument der Sinnlichkeit, dieses Erlebnis wird von der Bundeskunsthalle aus gutem Grund zum Höhepunkt ihrer großen Wim-Wenders-Ausstellung erklärt. So hat man einen Schnelldurchlauf durch Wenders‘ Werk noch nicht gesehen, obwohl wenn man weiterhin die Meinung vertreten kann, die klassische Kinoerfahrung sei immersiver als jede museale Kirmesattraktion. Um mit der Black Box konkurrieren zu können, ist das Bonner Viereckkino zu hell – und es riecht auch etwas muffig. Dafür ist es der einzige Saal der Ausstellung, in dem man nicht mit Sinnsprüchen an der Wand oder kuratorischem Weihrauch behelligt wird.
Am 14. August dieses Jahres wird Wim Wenders 80 Jahre alt. Seinen Platz in der internationalen Filmgeschichte hat er sicher, daran werden weder nörgelnde Kritiker noch Ausstellungen mit albernen Titeln wie „W.I.M. – Die Kunst des Sehens“ etwas ändern (die F.D.P.-hafte Abkürzung steht für „Wenders in Motion“). Sowohl als Spielfilm- wie als Dokumentarfilmregisseur hat Wenders einen unverwechselbaren Stil entwickelt, der ihm höchste Ehren eingetragen hat (den fehlenden Oscar kann er verschmerzen), der aber auch penetrant-pathetisch wirken kann. Selbst in seinen misslungenen Arbeiten finden sich jedoch immer Momente, die auf berührende Weise von der unerschütterlichen Liebe zum Film als Gesamtkunstwerk des 20. Jahrhunderts erzählen.
Auch die Kuratorinnen der Ausstellung scheinen sich entlang der Idee des filmischen Gesamtkunstwerks durch Wenders‘ Filmografie zu bewegen. Auf ein Vorspiel zur agnostischen Engellehre folgen Kapitel zum malenden, schreibenden und fotografierenden Wenders, zu seinen Vorbildern in Film und Kunst und zum musikalischen Soundtrack seines Lebens (also seiner Filme); als immer wieder neu entdeckte Sehnsuchtsorte werden Amerika und Japan vorgestellt.

Ausschnitte aus dem Film „Paris, Texas“ auf Leinwänden in der Ausstellung „W.I.M. Die Kunst des Sehens“ in der Bundeskunsthalle Bonn
Copyright: Oliver Berg/dpa
Allerdings ist dieses aus Musik, Literatur, Malerei, Fotografie und Film zusammengesetzte Gesamtkunstwerk in Bonn eine Wenders‘sche Ein-Mann-Schau. Mitwirkende kommen allenfalls als Inspirationsquelle und in Gestalt berühmter Freunde vor: Peter Handke, Paul Auster, Sebastião Salgado, Yōji Yamamoto. Hätte nicht wenigstens sein langjähriger Kameramann Robby Müller einen prominenten Auftritt verdient? So verlässt man die Ausstellung mit dem falschen Eindruck, Wenders‘ Bildsprache sei eine Kombination aus Hollywood, Edward Hopper und seinen eigenen Breitwand-Fotografien.
Anscheinend versteht die Museumswelt den Film lediglich nach den Kategorien der bildenden Kunst – mit dem Filmemacher als aus sich selbst schöpfendem Einzelgänger. In der Rainer-Werner-Fassbinder-Ausstellung in der Bundeskunsthalle ließ sich diese verklärende Tendenz bereits beobachten, bei Wenders steht sie nun (trotz der Mitwirkung des Frankfurter Filmmuseums) in voller Blüte. Immerhin ist Wenders dafür ein dankbares Objekt: Er studierte Kunstgeschichte und liebäugelte mit der Literatur, bevor er in der Pariser Cinémathèque zur Filmgeschichte fand.
Die Anfänge als Maler dürften selbst Wenders-Enthusiasten Neues bieten
Die Anfänge als Maler nehmen in der Ausstellung viel Raum ein und dürften selbst Wenders-Enthusiasten noch Neues bieten. Es sind typische Frühwerke, teils experimentell, teils Klassikern wie Paul Klee abgeschaut, mit unübersehbaren Zeichen von Talent. Allerdings ist es bestenfalls kurios, wenn die Kuratoren drei schöne, mit schwarzer Farbe hingehauchte Tanzszenen neben ein Filmstill aus „Pina“ hängen, als habe Wenders in den 1960er Jahren bereits den Ausdruckstanz vorausgeahnt.
Ansonsten wandelt der Besucher durch eine unüberschaubare Menge an Standfotos und anderem Begleitmaterial, vorbei an trivialen Zitaten und an Zwischenwände projizierten Filmausschnitten. Das fotografische Werk von Wenders wird eher illustrativ verwendet, als Beleg dafür, dass all seine Talente in seinen Filmen zusammenfließen. Im archivarischen Teil, dem Rausschmeißer der Schau, finden sich Schriftsätze, eine (seltsam beliebige) filmhistorische Bibliothek und Vitrinen mit den Pokalen der Filmkulturindustrie. Derart aufgereiht sehen all die Bären, Leoparden und bayrischen Porzellanfiguren verdächtig nach Nippes aus. Aber allein für den goldenen Frosch, den Wenders beim polnischen Festival Camerimage für seine „einzigartige visuelle Sensibilität“ verliehen bekam, hat sich die Mühe gelohnt.
Als beinahe 80-Jähriger wird Wim Wenders in der Bundeskunsthalle gleichsam zum Staatskünstler erhoben. Womit hat er das verdient? Sein Frühwerk bis „Paris, Texas“ ist eher etwas für den kleinen Kreis der Filmliebhaber, am erfolgreichsten war er, wenn er die geduldigen Sitzreihen des Arthouse-Kinos bewirtschaftete – mit raunendem Engelskitsch oder Dokumentarfilmen wie „Buena Vista Social Club“, „Das Salz der Erde“, „Pina“ und zuletzt „Anselm – Das Rauschen der Zeit“. Man kann für ihn nur hoffen, dass er nicht mit diesem Gesamtkunstwerk in Erinnerung bleiben wird.
„W.I.M. – Die Kunst des Sehens“, Bundeskunsthalle, Museumsmeile, Bonn, Di.-So. 10-18 Uhr, Mi. 10-21 Uhr, 1. August 2025 bis 11. Januar 2026