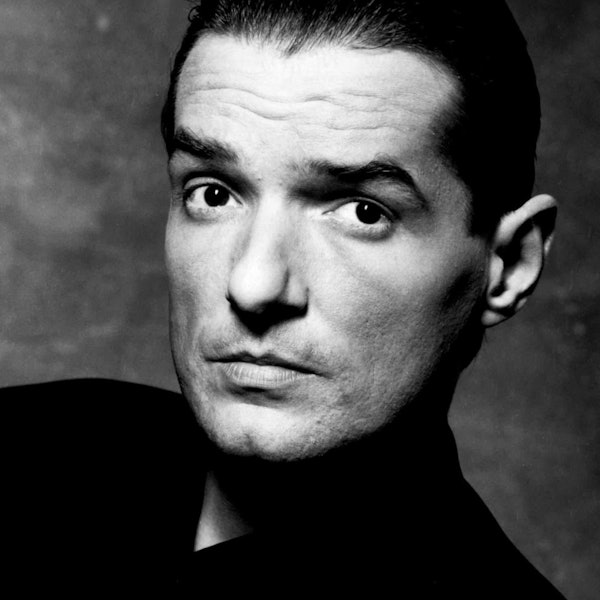Sängerin Phoebe Bridgers in Köln„Fuck J.K. Rowling!“

Phoebe Bridgers im Kölner E-Werk
Copyright: Martina Goyert
Köln – Es ist noch einen Monat hin bis zu ihrem 28. Geburtstag, aber in Köln wird Phoebe Bridgers bereits reichlich beschenkt. Bilder, Buttons, Poesie-Alben fliegen auf die Bühne, auch ein Cowboyhut mit LED-Blinklicht, den die Sängerin aus Pasadena prompt einen Song lang trägt. „Cute“, kommentiert Bridgers Präsent um Präsent mit der ihr eigenen Lakonie, „supersüß, supernett.“
Ihren berühmten Skelett-Onesie trägt sie inzwischen in einer Version als Kleid, die weißen Rippenknochen sind mit Schmuck verziert.
Dieses drängende Bedürfnis, Bridgers etwas Selbstgebasteltes zurückzugeben, oder auch Privatestes mitzuteilen, ergibt sich offensichtlich aus ihren Songs, deren Texte das vorwiegend junge, vorwiegend weibliche Publikum im E-Werk vollständig mitsingen kann.
Unverblümte Statements im E-Werk
Aber eben nicht so offensichtlich. Denn obwohl sich Phoebe Bridgers Lieder aus persönlichem Erleben speisen – grob gesagt erkundet ihr Debütalbum „Stranger in the Alps“ die Abgründe ihrer Depression, während der Nachfolger „Punisher“ den beschwerlichen Weg zurück an die Oberfläche beschreibt –, vermeiden sie doch das bloß Bekenntnis- oder Tagebuchhafte. Phoebe Brigders Kunst besteht eher in der Kombination von eindrücklichen, verrätselten Bildern mit unverblümten Statements.
Zum Beispiel „ICU“, das Stück in dem sie mit ihrem Schlagzeuger Marshall Vore Schluss macht, der nicht nur immer noch in ihrer Band spielt, sondern hier auch mitkomponiert hat: Die ersten Zeilen beleihen Andrew Wyeth’ ikonisches Gemälde „Christina’s World“ als Bild für die Unerreichbarkeit häuslichem Schutz und Friedens, später wird der Ex-Freund selbst als Kunstwerk beschrieben, dem die Sängerin freilich so nahe gekommen ist, dass sie nur noch die einzelnen Pinselstriche zu sehen vermag – worauf der unmissverständliche und gänzlich unpoetische Satz „I hate your mom“ fällt.

Phoebe Bridgers im E-Werk
Copyright: Martina Goyert
Mit Bridgers Musik verhält es sich ganz ähnlich: Ihre Rhythmusgitarre steht im Zentrum und schreibt eine lange Tradition von der kargen Appalachen-Ballade bis zum großen Vorbild Elliott Smith fort, mit ihrer fünfköpfigen Band aber malt sie exotische, liebliche, gelegentlich auch mal schroffe Klangbilder über diese schwarz-weißen Vorzeichnungen.
Seinen End- und Höhepunkt erreicht das Konzert dann mit der apokalyptischen Landschaft von „I Know the End“, für das die Künstlerin ihre Vorgruppe Sloppy Jane mit auf die Bühne bittet: Erneut taucht ein verwunschenes Haus am Horizont auf und während Bridgers das Ende aller Dinge verkündet, beschwört die erweiterte Band eine gewaltige Kakophonie herauf.

Im Duett mit ihrem Tourmanager Jeroen Vrijhoef
Copyright: Martina Goyert
Feuerrot leuchtet dazu die Bühne auf. Niemand fasst das Aufwachsen in Erwartung kommender Feuerstürme derzeit so eindrücklich wie die Kalifornierin, kein Wunder, dass ihr die jungen, wunden Herzen zufliegen und dass die wachesten Künstler vorangehender Generationen unbedingt mit ihr zusammenarbeiten wollen, von Taylor Swift über Fiona Apple bis hin zu Paul McCartney.
Wenn Bridgers die Stimme ihrer Generation ist, hat sie jedenfalls kein Problem damit, diese Bürde zu schultern: Nachdem der ultrakonservative Supreme Court das amerikanische Abtreibungsrecht gekippt hat, berichtete sie im US-Fernsehen freimütig von der Abtreibung, die sie im vergangenen Jahr vornehmen musste und sammelte eifrig Spenden für diverse Pro-Choice-Organisationen.
Das könnte Sie auch interessieren:
Auch in Köln kommentiert sie den Rückfall ihres Landes ins Mittelalter noch einmal mit maximaler Entrüstung, erzählt, wie der vor allem die Schwächsten und Schutzlosesten trifft.
Und als Bridgers ein hochgerecktes Schild kommentiert, das sie vorteilhaft mit ihrem Frisurzwilling Draco Malfoy vergleicht, verteidigt sie nicht nur den Slytherin-Fiesling – „Draco ist eine 10“ –, sondern vergisst auch nicht anzufügen: „Fuck J.K. Rowling, obviously“. Großes Gejohle, die transfeindliche „Harry Potter“-Autorin hat es sich mit ihrer einstigen Zielgruppe gründlich verscherzt.