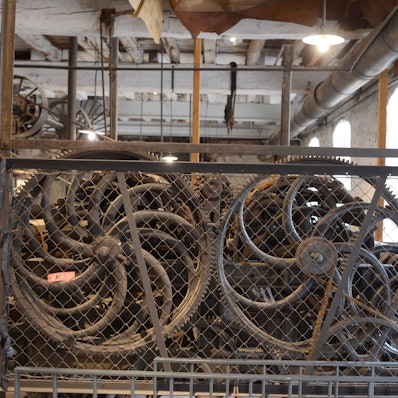Im Hubert-Salentin-Museum offenbarte der Vortrag „Rückriem über Rückriem“ neue Einblicke in das Wirken des bekannten Bildhauers.
BildhauereiJuliane Rückriem sprach in Zülpich über die Arbeit von und mit Ulrich Rückriem

Die Chlodwig-Stele ist Teil des Rückriem-Skulpturenwegs bei Langendorf. Sie erinnert an die Schlacht zwischen den Franken unter König Chlodwig und den Alemannen, die 496 auf der Gemarkung stattgefunden haben soll.
Copyright: Stefan Lieser
Er habe kein Atelier und auch keinen Kran, um die tonnenschweren Steine zu transportieren. Diese und andere Einsichten in das künstlerische Werk und die Arbeit ihres Vaters, des bekannten Bildhauers Ulrich Rückriem, gab jetzt Juliane Rückriem. Sie hielt dazu auf Einladung des Hubert-Salentin-Museums den Vortrag „Rückriem über Rückriem“.
Im Zülpicher Stadtteil Langendorf ist ein ganzer Skulpturenweg mit Arbeiten des heute 87-Jährigen zu besichtigen. Darunter auch die 1999 aufgestellte Chlodwig-Stele aus rosafarbenem Granit aus einem Steinbruch in Galizien. Das acht Meter hohe Kunstwerk markiert den wahrscheinlichen Ort der legendären Schlacht zwischen dem Frankenkönig Chlodwig und den Alemannen im Jahr 496.
Eine Landmarke, wie sie Ulrich Rückriem in ganz Deutschland installieren konnte. „Seine Kunst ist oft im öffentlichen Raum. Sie ist für uns alle da“, so Tochter Juliane Rückriem. Die Fotografin hat die Arbeiten ihres Vaters nicht nur dokumentiert, sondern oft auch deren Umsetzung und Installation vor Ort mit ihrem Team aus erfahrenen Steinmetzen und Handwerkern geleitet.
Steine für Kunstinstallationen sind zu schwer für Ausstellungsräume
In ihrem abwechslungsreichen Vortrag ging es Juliane Rückriem vor allem um Anekdoten aus den Jahrzehnten, in denen sie die Installation der oft meterhohen und meist aus Granit gefertigten Skulpturen ihres Vaters leitete. Mit Galerien habe man dabei eher selten zusammengearbeitet – die Böden der Ausstellungsräume trugen die tonnenschweren Steine einfach nicht.

Über die Arbeit ihres Vaters berichtete Juliane Rückriem.
Copyright: Stefan Lieser
Ihr Vater habe schon immer einen Hang zu großen Steinen gehabt, so Rückriem. Stelen, Scheiben, langgestreckte Kuben, liegende und stehende Reliefs: Das seien die minimalistischen Grundformen, die er bevorzuge. Der Schaffensprozess beginne in aller Regel mit der Idee, es folge die Suche nach dem Stein in zuvor als geeignet befundenen Steinbrüchen wie dem Dolomittagebau bei Anröchte oder einem Granitabbau in Galizien.
Steine, unbearbeitet und intakt, finde der Künstler aber auch auf der Börse des Steinkais im Hafen von Antwerpen. Es folgt eine Schemazeichnung des Projekts mit exakt vorgegebenen Spaltungen und Schnitten. Und dann hängt alles von einem kundigen und aufgeschlossenen Steinbruchmeister ab, der über die nötigen großen Sägen verfügt, etwa eine mit Diamanten besetzte Seilsäge für horizontale Schnitte. Zudem ist eine geeignete Steinmetzwerkstatt erforderlich. Die Handwerker setzen letztlich das um, was Rückriem will. Zentimetergenau.
Eine Frage der Kunst oder des Materials?
Hinter den sichtbaren Spaltungen und Schnitten stehe dabei keine große Kunstphilosophie, so Juliane Rückriem mit einem Seitenhieb auf die Kunstkritik: „Es geht vielmehr darum: Welches Material habe ich? Welches Volumen muss ich spalten? Wie ist der Steinbruchmeister gelaunt?“ Das wirkte doch etwas banal, denn Rückriems Skulpturen, die grundsätzlich jede vorher zwingend nötige „Verletzung“ (Juliane Rückriem) des Ausgangsblocks wie Schnitte, Spaltungen und Bohrlöcher offenlegen, wirken ja gerade durch die Spannung.
Der Granitkoloss, in eine Kunstform gebracht, bestehend aus sichtbar getrennten Teilen, die wieder zu einem neuen Ganzen zusammengesetzt sind. Die Schwere des Monoliths wirkt, indem man seine Bearbeitung nachvollziehen kann, zugleich aufgehoben.
Ulrich Rückriem stellte auch in New York aus
Der kunstvolle Minimalismus Rückriems, der seine Arbeiten unverwechselbar macht, hat Sammler, Museen und Ausstellungsmacher weltweit begeistert. Dreimal war Ulrich Rückriem zur Documenta in Kassel eingeladen, er war auf der Biennale in Venedig, stellte unter anderem in New York aus. Bodenreliefs sind im südlichen Innenhof des Reichstagsgebäudes zu sehen, auf öffentlichen Plätzen seine Stelen, Scheiben, Kuben, die Denkmäler sein können, etwa für Heinrich Heine in Bonn. Rückriem hatte Professuren an den Kunsthochschulen in Hamburg, Düsseldorf und am Städelmuseum in Frankfurt inne.
Die Stele „Ursprung“ aus dem Jahr 2017, ebenfalls von der Manfred-Vetter-Stiftung für Kunst und Kultur gekauft, ist eine der letzten Steinarbeiten Ulrich Rückriems. Heute lebt er in Köln und konzentriert sich laut seiner Tochter mittlerweile aufs Zeichnen. Am drei Kilometer langen Skulpturenweg bei Langendorf kann man sehen, wofür er tatsächlich steht. Den Zülpichern wurde anhand einer seiner Stelen bewusst gemacht, wo einst die berühmte Chlodwig-Schlacht stattgefunden hat. Die Chlodwig-Statue auf dem Marktplatz ist lediglich eine Figur aus dem Katalog.