Bruckner-CDs zum JubiläumParade der Pultstars bei Berliner Philharmonikern
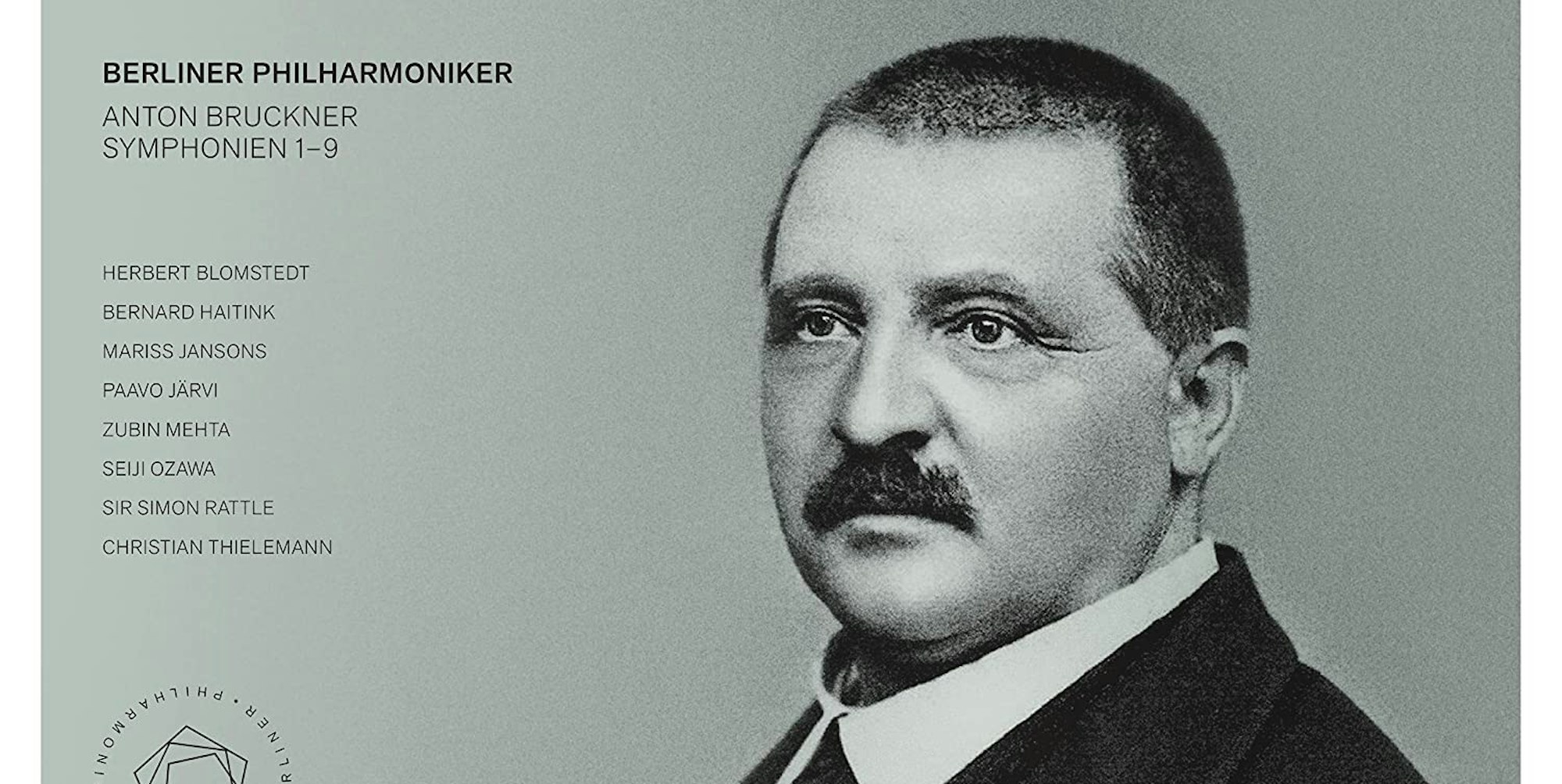
Das Cover der schmuck-unhandlichen CD-Box
Copyright: Berliner Philharmoniker Recordings
Köln – Das Beethoven-Jubiläum (250. Geburtstag) ist gerade überstanden, aber schon dräut in der Gedenktagfolge das nächste Großereignis: 2024 feiert die Musikwelt den 200. Geburtstag von Anton Bruckner. Das ist noch zwei Jahre hin, trotzdem gehen die Berliner Philharmoniker – genauer: ihre Tonträger-Verwertungsfirma Berliner Philharmoniker Recordings – schon jetzt in die Vollen. Und wer hat, der hat: Auf neun in schick-unhandlicher Box versammelte CDs (plus drei Blue-ray-Discs mit Konzertmitschnitten und Dirigenten-Statements, eine Blue-ray-Audio und ein üppiges Booklet) gebannt, erklingt das sinfonische Gesamtwerk des Spätromantikers (außer der vom Meister selbst verworfenen „Nullten“) aus Scharouns legendärem Konzertsaal, und zwar in einer quasi-experimentellen Konstellation: Das Orchester ist das nämliche, aber die Dirigenten wechseln – lediglich für die vierte und die fünfte Sinfonie hat man mit Bernard Haitink den nämlichen Pultstar genommen. Dass da sehr unterschiedliche Komponisten- und Werkauffassungen realisiert werden, ist sowohl erwartbar wie auch explizites hermeneutisches Anliegen der Edition. Einen „Einheits-Bruckner“ soll es hier nicht geben – weil es ihn von Haus aus nicht gibt.
Der Erbe der Wiener klassischen Sinfonik, der tiefgläubige Organist von Sankt Florian, der Wegbereiter der zweiten Wiener Schule, der Idylliker der oberösterreichischen Landschaft, der Konstrukteur weitgespannter Unendlichkeiten – das sind sehr heterogene Aspekte, die indes allesamt ihre Berechtigung haben und je nach dem auch in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen zusammenschießen (der katholische Weihrauch hat sich freilich in nahezu allen neueren Interpretationen verzogen).
Die Berliner haben eine lange und ehrwürdige Bruckner-Tradition, für die die Dirigentennamen Nikisch, Furtwängler, Karajan und Abbado stehen. Einschlägige Klangdokumente kommen in der neuen Ausgabe nicht vor, denn man wollte Bruckner offensichtlich auch auf dem neuesten Stand der Aufnahmetechnik präsentieren. So gehen die Einspielungen nicht mehr als zehn Jahre zurück, die älteste – just die erste Sinfonie unter Seiji Ozawa – stammt aus 2009, die jüngste – die zweite mit Paavo Järvi – aus 2019. Dazwischen treten außer Haitink Herbert Blomstedt, Mariss Jansons, Christian Thielemann, Zubin Mehta und, naheliegend genug, Simon Rattle ans Pult. Das ist, was immer man im einzelnen dazu sagen mag, eine imposante Phalanx der dirigierenden Bruckner-Kompetenz.
Der satisfaktionsfähige Bruckner beginnt gemeinhin mit der dritten Sinfonie. Nun ist aber gerade eine Totale wie die vorliegende Anreiz genug, auch als Hörer einmal an die Wurzeln des Phänomens zu gehen. Und siehe da: Der Gang lohnt sich, Paavo Järvi etwa lässt die Zweite straff, durchsichtig, ohne jeden Weihrauch, sehr „klassisch“ ertönen. Auch wenn er sich in die weitgespannten Kantilenen des zweiten Satzes hineinlegt – hier ist noch eine ganze Portion von jenem Beethoven am Werk, dem der Este mit seinen legendären Gesamtaufnahme der Sinfonien mit der Deutschen Kammerphilharmonie huldigte.
„Altersjugendlichkeit“
Es führte an dieser Stelle zu weit, gänsemarschmäßig jede Aufnahme in ihrer Spezifik zu würdigen. Auch kann hier die – jeweils unterschiedliche – Handhabung der Fassungswahl nicht diskutiert werden. Erwähnt werden muss indes auf jeden Fall die Vierte des jüngst verstorbenen Haitink. Hier erstaunt vor allem die „Altersjugendlichkeit“ der Interpretation, die es jedenfalls im Ergebnis nicht bei jener grandseigneuralen Abgeklärtheit belässt, die seine gelassen-sparsame Pultpräsenz nahelegte. Nicht nur lässt Haitink mitunter ganz schön aufdrehen – was nicht eine Frage des Tempos ist. Nahezu ein Wunder ist vielmehr immer wieder die räumliche Klangdisposition, die wohl in der Konfrontation der verschiedenen Instrumentalsoli im Jagd-Scherzo auf den Gipfel kommt. Hier begibt sich ein Kammerspiel vom Feinsten. Trotz allem darf man ein wenig bedauern, dass bei diesem Unternehmen nicht Haitinks Leib-und-Magen-Bruckner – die Siebte nämlich – zum Zuge kam.
Ins Trommelfell gebohrt
Dieser nimmt sich Thielemann an, der zweifellos einen besonderen Zugang zu dieser angeblich „heiteren“ Sinfonie wählt. Er schafft es zum Beispiel, aus der Orgelpunkt-Steigerungsstelle im ersten Satz (Takte 103ff.) einen Vorgang zu machen, der sich mit lustvoll-quälender Intensität ins Trommelfell bohrt. Auch von der angeblichen Kathedral-Architektur der Bruckner-Sinfonik bleibt da nicht mehr viel übrig. Thielemann dynamisiert, dramatisiert und individualisiert schmerzhaft die Verläufe als Ereignisse in einem sehr menschlichen Hier und Jetzt – freilich in einer Weise, dass die Spannungslösung am Ende von Exposition und Reprise umso erlösender und befriedeter klingt.
Schließlich Rattle mit der Neunten, die sich hier dadurch auszeichnet, dass die Vervollständigung des vierten Satzes durch Samale-Phillips-Cohrs-Mazzuca mitgeliefert wird, also eine komplette Sinfonie erklingt. Ob man damit dem Torso, dem gerade durch seine Nicht-Vollendung eine unvergleichliche Aura zuwächst, einen Gefallen tut, sei dahingestellt – die Sache ist umstritten und wird dies auch bleiben.
Zerklüftete Klanglandschaft
Hätte Rattle mit dem Adagio abgeschlossen, wäre jedenfalls auch das ein in jeder Hinsicht überzeugendes Finale gewesen. Eine zerrissene, zerklüftete Klanglandschaft tut sich da auf, die bereits auf Mahler vorausdeutet. Rattle lässt die Trümmer auch nebeneinander stehen, ohne den Versuch einer harmonisierenden Vermittlung zu machen. Auf der anderen Seite ist er sich der überwölbenden motivischen Zusammenhänge offenkundig jederzeit bewusst – wenn etwa die Hörner an der erschütternden Kreuzsymbol-Stelle gut hörbar das Nonenmotiv (hier allerdings die große None) des Satzbeginns aufgreifen.
Nichts prinzipiell gegen die Rekonstruktion des Finales, dennoch wirkt sie mit ihrem affirmativen D-Dur-Jubel am Schluss gerade nach diesem dritten Satz irgendwie auf eine schale Weise versöhnend. Indes: Wenn eine solche Gesamtedition, die üblicherweise keinen Streit provoziert, das im vorliegenden Fall vielleicht doch tut, dann ist auch das nur zu begrüßen.
Bruckner: Symphonien 1–9; Berliner Philharmoniker unter verschiedenen Dirigenten (Berliner Philharmoniker Recordings (9 CDs, 3 Blue-ray-Discs, 1 Blue-ray-Audio))
