Nach seinem Kultbuch „Allegro Pastel“ fordert Leif Randt: „Let's talk about feelings“. Aber bitte schön vernunftgesteuert.
Neuer Roman von Leif RandtMillennial in der Midlifekrise

Leif Randt gilt als Kul. Er ist mit seinem Buch âÄžAllegro PastellâÄœ für den Leipziger Buchpreis 2020 nominiert. +++ dpa-Bildfunk +++
Copyright: picture alliance/dpa/Kiepenheuer & Witsch
Die Bandbreite an Hosenformen, die er derzeit in seiner Berliner Boutique anbietet, erzählt Marian seinem besten Freund Piet im Podcast-Gespräch, sei so groß wie noch nie. Er benutzt dabei das Wort „Pluralität“. „Hosenschnitte als Vorboten einer neuen Toleranzgesellschaft?“, folgert Piet und Marian bekräftigt: „Ja ... Ja, bitte!“
Viel politischer wird es nicht in Leif Randts neuem Roman „Let's talk about feelings“. Das verrät bereits das Cover, ein verschwommenes Flugzeug vor orange glühendem Himmel, der Titel in silbern changierender Schreibschrift vervollständigt die Poesiealbum-Optik.
Vor zehn Jahren hat der 1983 geborene Autor mit „Planet Magnon“ eine veritable Science-Fiction-Utopie veröffentlicht und darin die Philosophie der „PostPragmaticJoy“ entworfen, eine sanfte Art der Selbstdisziplinierung, mit deren Hilfe man versucht, einen idealen Dauerschwebezustand zwischen „Rauscherfahrung und Nüchternheit, Selbst- und Fremdbeobachtung, Pflichterfüllung und Zerstreuung“ zu halten.
Drogen, ja bitte, aber in Maßen
Aber auch die Protagonisten von Randts mehr oder weniger zeitgenössischen Romanen, das Um-die-30-Paar Tanja Arnheim und Jerome Daimler in „Allegro Pastell“ – dem Kultbuch der Millennials – ebenso wie der 41-jährige Marian Flanders, seine Freunde, Halbgeschwister und romantischen Interessen in „Let's talk about feelings“ scheinen dieser Alltagsphilosophie zu folgen. Sie gönnen sich den Exzess nur begleitet von der Beobachtung, dass dieser nach einer Zeit der Zurückhaltung in der Ordnung der Dinge just an der Reihe sei.
Sie leben in einer wattierten Welt, die aus Mikroreibungen und kleinen Triumphen eine statistische Mitte sucht, die jede soziale Aktion sorgsam plant und anschließend selbstkritisch hinterfragt, vom Wannsee-Begräbnis der sehr verehrten Mutter Marians – einer Model-Ikone zu Zeiten der Bonner Republik – bis zum leicht irren Liebesbrief einer begehrten Filmregisseurin, den der Boutiquenbesitzer von gleich zwei Vertrauten abgleichen lässt, bevor er ihr antwortet. Streckenweise liest sich das, als hätten Randts Protagonisten Pierre Bourdieus Habitus-Theorie verinnerlicht, sie dabei freilich jeglichen Klassenbewusstseins entkleidet.
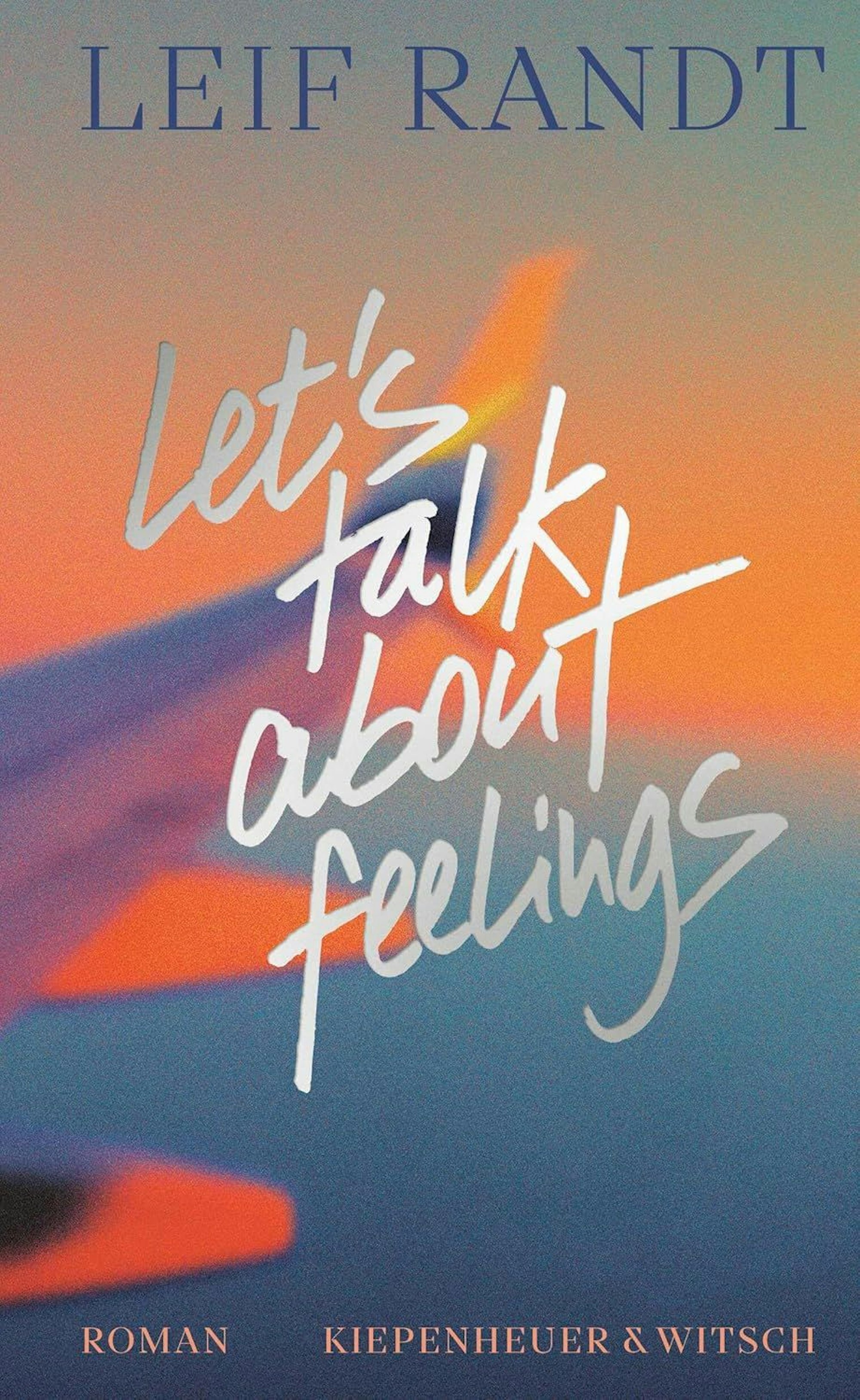
Das Cover von „Let's talk about feelings“
Copyright: Kiepenheuer & Witsch
Marian steigt nicht aus, er macht ein „Mini-Sabbatical“ und wenn er doch mal kapitalismuskritisch aufbegehrt, bestellt er aus chinesischen Quellen gut gefälschte Designerware und stellt die in seinem Laden in seinem „Kenting Beach“-Laden als eine Art Installation neben der Markenkleidung aus. Als kleine Geste gegen den Elitarismus der Mode.
Man kann all das hochironisch verstehen, oder sogar mit einem Schuss Empörung. Wie kann man sich nur über Hosenschnitte unterhalten, während die Welt vor die Hunde geht? Es gibt eine Szene spät im Roman, in der sich Marian, der seiner Regisseurin nach Indien gefolgt ist, mit einem Praktikanten des Goethe-Instituts über deren Debütfilm unterhält. „Ich lese dieses getriebene Einkaufen in Outlet-Centern schon als Kritik an der Art und Weise, wie in heutigen Gesellschaften mit Verlust umgegangen wird“, sagt der Praktikant. Marian, selbst noch in Trauer um seine Model-Mutter, ist überrascht. Die angebliche Konsumkritik war ihm völlig entgangen: „Ich glaube, das ist einfach ein ehrlicher und humorvoller Film über eine Freundschaft.“
Optimistischerer Blick auf die Welt
Doch der Ironieverdacht geht fehl, schlimmstenfalls wirkt Marians Naivität entwaffnend. Bestenfalls mag man sie als völlig unironisch gemeintes Best-Practice-Beispiel lesen, ein Plädoyer für einen offeneren, optimistischeren Blick auf die Welt. Denn auch dieses Sittengemälde alternder Ex-Hipster in einem Berlin, das dermaßen an Glanz verloren hat, dass selbst vom VW-Konzern organisierte EDM-Partys in Wolfsburg ihm Konkurrenz machen, trägt noch die Züge einer beinahe idealen Gegenwelt.
In der regiert kein Kanzler Merz, sondern die fiktive linksliberale „Progress 16“-Partei, deren Programm digitaler Direktdemokratie und technikgestützter Lösungen an die Regierungsform des Planeten Magnon erinnert. „Das sind unsere Leute, die jetzt regieren“, erklärt Marians Podcast-Kumpel Piet, „die machen unsere Fehler. Und wenn der Aggro-Mainstream dagegen anstinkt, setz ich mich high vors Kanzleramt und verteidige den Fortschritt.“
Optimiert ist zumindest die Midlifekrise, in die Marian nach dem Krebstod der Mutter hinzuschlittern fürchtet, stattdessen durchlebt er sein Trauerjahr gestützt von Freunden, nimmt Drogen in idyllischen Wäldern und gut durchlüfteten Clubs, knüpft engere Bande zu seinen jüngeren Halbgeschwistern und zu seinem Vater, dem ehemaligen „Tagesthemen“-Moderator, der sich jetzt auf Tiktok versucht, ja selbst zu seiner schwangeren Ex-Freundin. Die Liebe misslingt, dann gelingt sie doch, im Rahmen des Vernünftigen: „Falls du mich eines Tages nicht mehr leiden kannst“, eröffnet Marian seiner neuen Freundin nach einem Handjob in der Marzahner Parkanlage Gärten der Welt, „werde ich diesen Tag trotzdem in guter Erinnerung behalten.“
Mitunter ist „Let's talk about feelings“ ziemlich witzig, immer jedoch absolut zwingend, gerade in seiner reizarmen Ereignislosigkeit. Kein anderer deutscher Autor entwickelt in seinen Romanen solch einen videospielartigen Sog, einzig Leif Randt gelingt das Kunststück, so viel von unserer Realität auszublenden und dabei doch alles über diese Zeit, über ihre Ängste, ihre Hoffnungen, zu erzählen.
Leif Randt: „Let's talk about feelings“, Kiepenheuer & Witsch, 320 Seiten, 24 Euro, E-Book: 19, 99 Euro.

