Die neue CD Box der Deutschen Grammophon folgt Interpretationen von Mozart und Bach, wie sie heute nicht mehr aufgeführt werden.
Klaviermusik von Carl SeemannNeu ist nicht immer besser
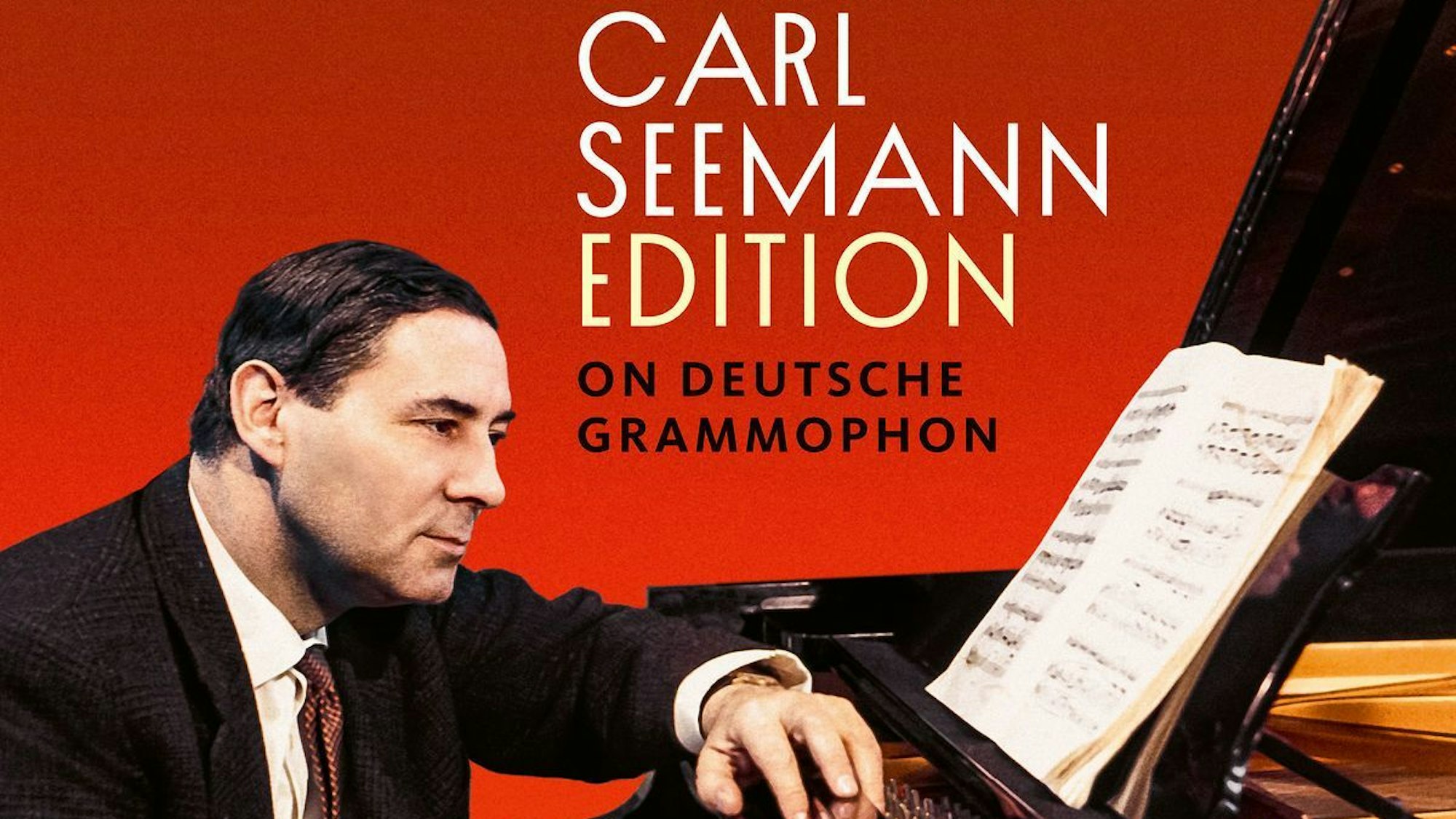
Cover der neuen CD Box des Bremer Pianisten Carl Seemann
Copyright: Deutsche Grammophon
Es gibt bedeutende Pianisten, deren Spiel und Interpretationsmaximen über Jahrzehnte nicht nur stilbildend wirkten, sondern ihrerseits auch kongenial der Auffassung ihrer Zeit entsprachen, wie diese oder jene Musik zu klingen habe. Die dann aber irgendwie und ohne dass sie „schlechter“ gespielt hätten, außer Kurs kamen und ins Abseits der Rezeption gerieten. Die österreichische Pianistin Ingrid Haebler, die in 60er Jahren als Mozart-Göttin galt, ist so ein Fall – sie wurde in ihrem Metier von Barenboim, Brendel und Schiff abgelöst.
Ähnlich liegen die Dinge bei dem gebürtigen Bremer Carl Seemann (1910-1983), der, seit 1946 Inhaber einer Klavierprofessur an der Freiburger Musikhochschule, in den Jahren nach dem Krieg aus dem deutschen Musikleben nicht wegzudenken war. Er avancierte zum Hauspianisten der Deutschen Grammophon, setzte mit Bach- und Mozart- wie mit Interpretationen der musikalischen Moderne Akzente, formierte mit dem Geiger Wolfgang Schneiderhan ein gefeiertes Duo des Beethovenspiels.
Neue CD-Box der Deutschen Grammophon
In den 70ern war Seemanns große Zeit dann aber vorbei: Zu nüchtern, zu „kalt“, zu asketisch, zu „mager“ galt auf einmal sein Stil, Kritik und Publikum wünschten sich die neue Subjektivität, ein vielfarbigeres, auch virtuoseres Spiel. Dass diese Neuorientierung nicht die ultima ratio, sondern ihrerseits zeitgebunden, also relativ und revisionsanfällig war, diese Erkenntnis drängt sich auf, wenn man in die CD-Box (25 CDs, eine Blue-ray-disc) hineinhört, die die Deutsche Grammophon jetzt unter dem Titel „The Complete Carl Seemann Edition“ herausgebracht hat.
Hier wird die einschlägige Sektion des Label-Archivs vollständig zum Leben erweckt – mit Bach- und vielen Mozartaufnahmen (inklusive einiger Klavierkonzerte unter anderem mit den Berliner Philharmonikern) über die Duo-Einspielungen (Mozart, Beethoven, Brahms) mit Schneiderhan, über Schubert und Schumann bis zu Debussy, Bartók und Strawinsky, Fortner, Klebe und Hartmann. Ein informatives Begleitheft liefert das Framing zu Seemanns Position in der Deutungsgeschichte.
Carl Seemann bezog sich stark auf Bachs Werkarchitektur
Neusachlich, antiromantisch, mager? Vorsicht, diese Begriffe gedeihen leicht zu Klischees – und dies zumal dann, wenn sie nicht beschreibend, sondern (pejorativ) wertend platziert werden. Richtig ist: Seemann kam von der Orgel her, war pianistisch in der Leipziger Bach-Sphäre sozialisiert worden. Diese Prägung verlieh seinen Interpretationen einen strukturalistischen, stark auf die Werkarchitektur bezogenen Zug.
Man merkt das zum Beispiel an seiner Aufnahme von Bachs Chromatischer Fantasie und Fuge. Zugegeben, sehr „fantastisch“ klingt die Eröffnung der Fantasie nicht. Dafür stellt Seemann deren Formverlauf über Rezitativ, Arpeggio und Quasi-Choral und die damit verbundene Steigerung eindrucksvoll konsequent heraus.
Der Pianist reduzierte die Musik auf das Wesentliche
Auch Mozarts Sonate KV 533/494 atmet rundum Bach’schen Geist, eine Romantisierung des kontrapunktierenden Seufzer-Motivs in der Durchführung des ersten Satzes versagt sich der Pianist durchaus. Hier ist eine unbestechliche Lauterkeit, ein strenger Ernst am Werk und zugleich eine gestochene Klarheit, die nichts Verschwurbeltes, Ungefähres kennt. Und die Bitterkeit der chromatischen Rückleitung zur Reprise im langsamen Satz wird keinem wohlfeilen Versöhnungsversuch ausgesetzt – sie kommt mit der kompromisslosen Modernität, mit der sie da steht.
Dann das große Mozart-Konzert KV 491: Seemanns unprätentiöse, uneitle Selbstzurücknahme zeigt sich nicht nur darin, dass er darauf verzichtet, die „Lücken“ in Mozarts Klavierpart ornamental aufzufüllen – dabei scheint es fast, dass die Reduktion auf das Wesentliche die lapidare tragische Größe dieser Musik erst zum Vorschein bringt. Vielmehr verweigert er die Selbstdarstellung sogar da, wo sie eigentlich angezeigt ist: Statt einer eigenen Kadenz im ersten Satz (Mozart hat keine hinterlassen) spielt er eine des Leipziger Thomaskantors August Eberhard Müller.
Neu ist nicht immer besser
Klar, dass Seemann auch für die gläserne, teils motorische Trockenheit in Debussys „Children’s Corner“-Stücken der richtige Mann ist. Der späte Brahms wiederum, den viele Spieler gerne sentimentalisieren, kommt bei ihm mit einem starken Bewusstsein für das Zerreißen des Gefüges, für die Trümmerhaftigkeit der in der Landschaft stehenden Motive. Auch dieser Komponist wird da eminent modern.
So wird man diese Edition insgesamt begrüßen dürfen – und sei es, weil sie wieder einmal zeigt, dass Interpretationsgeschichte nicht unbedingt die eines linearen Fortschritts ist. Oder anders gesagt: Das Ältere ist nicht immer das Schlechtere.
The Complete Carl Seemann Edition on Deutsche Grammophon (25 CDs, 1 Blue-Ray-Disc), 69,99 Euro.
