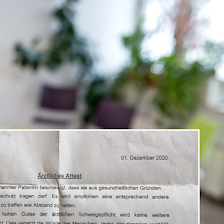Das Telegram-DilemmaWarum lassen sich verbotene Inhalte im Netz so leicht verbreiten?

Telegram zu einem Problem für den öffentlichen Frieden geworden. (Symbolfoto)
Copyright: picture alliance/dpa/TASS
- Warum ist es so schwierig ist, die Verbreitung verbotener Inhalte im Internet mit einer Netzsperre in Deutschland zu verhindern? Eine rechtliche Analyse.
Telegram ist ein Messengerdienst,mit dem man individuell oder in Gruppen mit bis zu 200.000 Mitgliedern kommunizieren kann. Weil dort auch Gewaltaufrufe verbreitet werden, ist Telegram zu einem Problem für den öffentlichen Frieden geworden. Kann man Telegram in Deutschland zur Not blockieren? Unterfällt der Dienst dem „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ (NetzDG), und was brächte das?
In Deutschland soll das NetzDG helfen, Hass im Netz zu bekämpfen. Anbieter von Kommunikationsdiensten, die „beliebige Inhalte mit anderen Nutzern teilen oder der Öffentlichkeit zugänglich machen“, haben nach dem Gesetz Pflichten. Sie müssen rechtswidrige Inhalte löschen, ein Meldeverfahren einrichten und Beschwerdemanagementsysteme vorhalten. Kommt es zu einer Straftat, wie etwa einem Gewaltaufruf durch einen Nutzer, dann muss der Anbieter das verfolgen, prüfen und verbotene Inhalte sperren. Damit er erreichbar ist, muss er einen Ansprechpartner in Deutschland benennen.
Man solle das NetzDG nachschärfen und durchsetzen, so lautet eine generelle Forderung vieler. Jede Nachschärfung sollte aber nicht allein auf Hoffnung gründen, sondern evidenzbasiert sein – vor allem nicht aktionistisch. Zumindest mit Blick auf den Anwendungsbereich des NetzDG scheint ein Nachschärfen nicht nötig. Da Telegram offene Gruppen von bis zu 200 000 Mitgliedern zulässt, dürfte der Dienst auch zum Austausch zwischen einer unbestimmten Anzahl von Personen geeignet sein. Die Anwendbarkeit des NetzDG ist damit also kaum zu bestreiten. Daran dürfte sich bei der Reichweite und Gefährlichkeit großer Gruppen auch nichts ändern, dass man zur Anmeldung – anders als bei Facebook – eine Telefonnummer benötigt. Spätestens seit der Ankündigung vom Oktober dieses Jahres, man werde künftig auf Telegram auch Werbung einbinden, dürfte auch die vom Gesetz genannte Gewinnerzielungsabsicht außer Frage stehen.
Das könnte Sie auch interessieren:
Doch wie steht es um die Durchsetzung eines Rechts, das auf Kooperation mit den Rechtsunterworfenen basiert? Schlecht, denn wie soll in Abhängigkeit von der Mitwirkungspflicht des zentralen Beteiligten außerhalb des Zugriffsbereichs des Staates ein theoretisch noch so scharfes Mittel durchgesetzt werden? Gar nicht. Alle Pflichten des Gesetzes gehen ins Leere, wenn ein Anbieter außerhalb des staatlichen Machtbereichs sie ignoriert. Das scheint Telegram mit Sitz vermutlich in Dubai zu tun. Das Unternehmen soll weder im Inland noch im Ausland ansprechbar sein, Bußgeldbescheide des Bundesamts für Justiz bislang schlicht ignorieren und ein insgesamt eigenwilliges Kooperationsverhalten an den Tag legen.
Wenn nun über einen Dienst verbotene Inhalte verbreitet werden und dieser sich weigert, rechtliche Pflichten zu erfüllen, kann man ihn dann nicht einfach per „Geoblocking“ aus dem „deutschen Internet“ aussperren? Geoblocking kennt man vor allem im Zusammenhang mit Urheberrechtsverletzungen. Wenn Anbieter von Diensten wie Netflix verhindern wollen, dass Nutzer aus einer bestimmten Region Datenkontakt zu ihrem Angebot aufnehmen und einen Film ohne Senderecht für das fragliche Gebiet dennoch abrufen, dann identifizieren und blockieren sie den Zugriff. Entscheidend ist, dass diese Maßnahme durch den Anbieter des Dienstes erfolgt, weil das Unternehmen diese Sperre etwa aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung zur Wahrung geistigen Eigentums errichten will.
Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien zurückhaltend
Will der Anbieter aber gar nicht sperren, sondern sollen seine Inhalte vielmehr umgekehrt und gegen seinen Willen vom und aus dem Netz ausgesperrt werden, kann der Staat aktiv werden. Dazu müssen Provider wie „1 und 1“ oder die Telekom durch den Staat dazu verpflichtet werden, Nutzer zu blocken, die über das „deutsche Internet“ den Dienst erreichen wollen. Es sind also sogenannte partielle Netzsperren für die Kommunikation über den Dienst erforderlich, die man bislang etwa aus China oder Russland kennt.
Der Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien ist hier zurückhaltend. Die neue Regierung will das Recht auf Anonymität sowohl im öffentlichen Raum als auch im Internet gewährleisten. Man will nur anlassbezogen und durch richterlichen Beschluss gesichert, im Einzelfall vorgehen. Mit „Login-Fallen“ will man grundrechtsschonend Täter identifizieren. Auf dieser Basis wird man die erforderlichen flächendeckenden Sperren nicht vornehmen können. Selbst wenn der Staat sich für ein staatliches Geoblocking per Netzsperre entschiede, wäre diese Maßnahme in vielen Fällen nutzlos, weil die Sperre technisch leicht umgangen werden kann.
Wer als Nutzer nicht möchte, dass seine Kommunikation per Telegram als solche erkannt wird, der kann seinen Netzverkehr leicht verschleiern. Dazu muss man nur einen sogenannten VPN-Tunnel benutzen oder den „Tor Browser“, der anonymeres Surfen sogar im Darknet ermöglicht. Wer die Sperre seiner Kommunikation umgehen möchte, der kann das tun. Unter Telegram-Nutzern dürfte sich längst herumgesprochen haben, wie man sich dem Zugriff des Staates entzieht. Spätestens nach einer Sperre würde sich vermutlich schnell eine Telegram-Community finden, die den Nutzern Tipps und Tricks zur Umgehung staatlichen Geoblockings vermittelt. Die Netzsperre per „Geoblocking“ hilft also nur gegen völlig unbedarfte Nutzer.