Lehrer in der Salafistenhochburg„Kommen wir in die Hölle, wenn wir Händchen halten?“

Fooladvand will, dass seine Schüler kritisch nachfragen.
Copyright: Thomas Banneyer
Aziz Fooladvand ist Islamlehrer an einer Realschule in der Salafistenhochburg Bonn-Tannenbusch. Er kämpft darum, die Schüler nicht an Islamisten zu verlieren.
[Lesedauer: rund 5 Minuten]
Manchmal fühlt sich Aziz Fooladvand wie ein einsamer Kämpfer gegen Windmühlen. "Wir können es uns nicht leisten, noch mehr Jugendliche an Salafisten zu verlieren", sagt der Islamlehrer und fügt pathetisch hinzu: "Wir führen hier im Klassenzimmer einen Kampf um die Rettung westlicher Werte, letztlich der Demokratie." Das mag einem hoch aufgehängt vorkommen - schließlich ist der Mann, der das sagt, nicht beim Verfassungsschutz, sondern unterrichtet Schüler. Aber Beschwichtigungsrhetorik oder rheinisch gelassenes "Wird schon" ist Fooladvand fremd. Dafür ist er zu nah dran an der Bedrohung: Er zeigt aus dem Fenster in der Freiherr-vom-Stein-Realschule in Bonn-Tannenbusch.
Dort hinter dem Schultor verteile der Salafistenprediger Pierre Vogel seine Broschüren. Und böte damit genau das, wofür viele muslimische Jugendliche empfänglich seien: Die einfache Wahrheit von Himmel und Hölle in einer komplizierten Welt, die für sie wenig Chancen bereithalte.Tannenbusch, das ist in NRW eine der Hochburgen des Salafisten-Netzwerks: Hier beherrschen Hochhäuser das Bild. 60 Prozent Migrantenanteil, jeder Dritte lebt von Hartz IV. Laut Polizei werben hier Salafisten aktiv um Nachwuchs. Von hier aus zog Al-Kaida-Terrorist Bekkay Harrach aus zum Dschihad nach Afghanistan, wo er starb. Hier lebte der Bonner "Kofferbomber" und Konvertit Marco G. In der Freiherr-vom-Stein-Realschule haben mehr als 80 Prozent der Schüler Migrationshintergrund, wie Schulleiter Martin Finke bestätigt. "Hier bündelt sich Armut mit allen Folgen: Arbeitslosigkeit, Verwahrlosung, Perspektivlosigkeit." Bedingungen, die das Himmelreich im Jenseits für viele attraktiv erscheinen ließen.
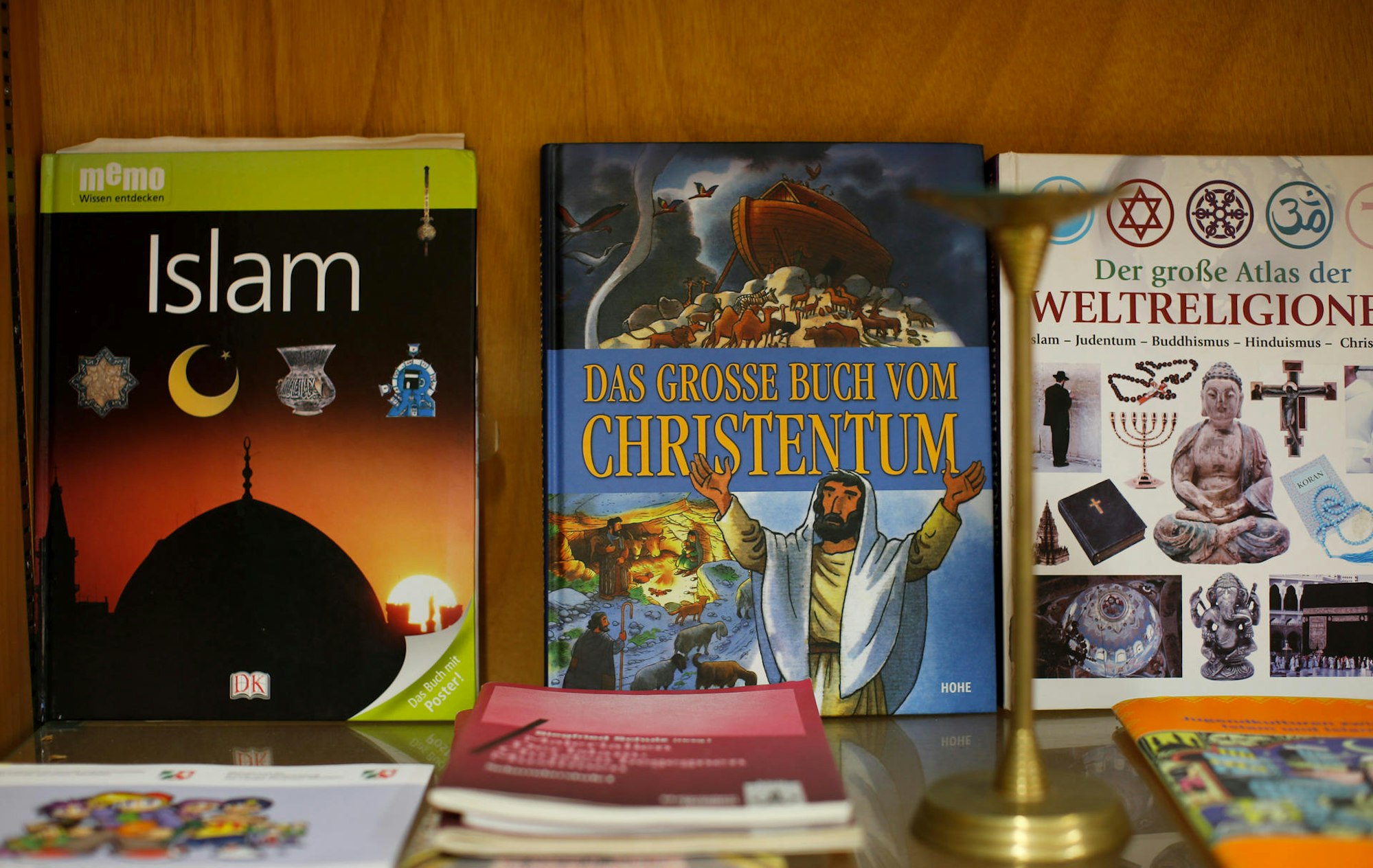
Interreligiösität ist ihm wichtig: Weg vom Absolutheitsanspruch einer Religion.
Copyright: Thomas Banneyer
Fotos der Kaaba, des islamischen Heiligtums in Mekka, schmücken die Wände des Unterrichtsraums - ebenso wie Koransuren. Vor Fooladvand auf dem Pult liegen der Koran und die Bibel. Ein fröhliches "Guten Morgen Herr Fooladvand", rufen ihm seine Zehntklässler entgegen. Dass sie ihren Lehrer mögen, ist sofort spürbar. "Hier bei Herrn Fooladvand dürfen wir uns ohne Angst austauschen. Das tut gut", sagt eine seiner Schülerinnen. Seit mehr als zwei Jahren begleitet Fooladvand die Klasse und erinnert sich noch gut an den Beginn: Wenn er etwa vor den Augen der Schüler den Koran in die eine und die Bibel in die andere Hand nehme, dann sei das für viele eine Provokation. "Die kennen als Instanz bis dahin nur den Imam." Aber Fooladvand liebt die Provokation.
Seit fast zehn Jahren unterrichtet der aus dem Iran stammende Quereinsteiger an der Schule Islamkunde. Als er anfing, war er schockiert darüber, wie viele seiner Schüler einem konservativen Islam anhängen. Dass sie sich teilweise mit einem aus seiner Sicht menschenverachtenden mittelalterlichen Gottesstaat identifizierten. Dass sich in Deutschland aufgewachsene Jugendliche mit wörtlich genommenen Koranversen aus dem siebten und achten Jahrhundert die Fragen des 21. Jahrhundert beantworten. In aller Radikalität. "Die Welt wird eingeteilt in haram und halal - also verboten und erlaubt."
„Darf ich einen Freund haben?“
Quälende Fragen der Jugendlichen seien da am Unterrichtsende an der Tagesordnung: "Kommen wir in die Hölle, wenn wir Händchen halten? Oder wenn ich onaniere? Darf ich einen Freund haben? Darf ich Weihnachten feiern?" Die innere Not sei riesig. Foolandvand hat seine Handynummer an die Schüler verteilt. Er ist immer ansprechbar, wenn es mal wieder einen seiner Schützlinge innerlich zerreißt - zwischen den eigenen Bedürfnissen in einer westlichen Welt und den Zwängen der Religion. "Es gibt in muslimischen Familien keine Tradition, mit seinen Eltern über solche Fragen zu reden. Daheim herrschen patriarchale Strukturen: Da kontrolliert der Vater den Ranzen, liest die Briefe seiner Töchter." Viele hätten bevor sie zu ihm in den Unterricht kommen noch nie vernunftorientiert über Religion gesprochen.

Aziz Fooladvand hat ein gutes Verhältnis zu seinen Schülern. Viele suchen auch außerhalb des Unterrichts seinen Rat.
Copyright: Thomas Banneyer
Genau hier setzt Fooladvand an: Der studierte Soziologe, Philosoph und Islamwissenschaftler ist Aufklärer. Kantianer, wie er selbst betont: Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Schüler in die Lage zu versetzen, selbst zu denken. Raus aus der Unmündigkeit. Er verurteilt seine Schüler nicht. Er fragt nach. "Ich hole sie vom Himmel in die Wirklichkeit zurück", nennt er das. Und zwar so lange, bis es beginnt, in ihnen zu arbeiten: "Warum trägst zu dein Kopftuch?" fragt er etwa. "Weil der Koran das sagt und der Imam." Mit solchen Antworten gibt sich Fooladvand nicht zufrieden. Er beginnt dann ein Gespräch über die identitätsstiftende Bedeutung des Kopftuchs, über soziale Normen. Schließlich lesen sie gemeinsam nach, was der Koran dazu sagt. Ganz am Ende fragt Fooladvand: "Glaubst du wirklich, du wirst von Gott in der Hölle gefoltert, wenn du deine Haare zeigst?" Die Antwort lässt er offen. "Ich habe keine fertige Wahrheit, die muss jeder für sich selber finden."
Fooladvand geht selbst in die Moschee. Das macht ihn glaubwürdig
Fooladvand ist selbst religiös, geht in die Moschee, wo er viele Schüler trifft. Das macht ihn glaubwürdig. Die meisten kommen in seinem Unterricht mit etwas in Kontakt, das familiär nie vermittelt wurde: eine interreligiöse Bildung. Dass der Islam auf dem Alten Testament, also auf der Thora aufbaut, und dass man das im Koran nachlesen kann, ist für viele ein Aha-Erlebnis. Hier im Unterricht hören sie davon zum ersten Mal. Dass die Schüler den Lehrer Fooladvand so ernst nehmen, hat aber auch mit seiner Geschichte zu tun: Er kämpfte in den 70er Jahren gegen den Schah von Persien für die islamische Revolution des Ajatollah Khomeini. Als er sich später enttäuscht abwandte und sich negativ zur islamischen Revolution äußerte, kam er ins Gefängnis, floh 1987 nach Deutschland. Seine Schüler glauben ihm, "weil er das alles ja auch selbst erlebt hat", sagt Hilina. Er vermittelt seinen Schülern, was es bedeutet, wenn die Scharia wortwörtlich ausgelegt wird. Einen Dieb, dem die Hand abgehackt wird, zeigt er auf Fotos ebenso wie Bilder von Menschen, die öffentlich blutig gepeitscht wurden. "Wenn man den Gottesstaat am eigenen Leib erlebt hat, bleibt einem nichts anderes übrig als diese Arbeit zu tun. "
Die wichtigste Säule seines Unterrichtes aber sei Vertrauen, sagt Fooladvand. "Ohne das Vertrauen meiner Schüler wäre mein Projekt gescheitert. Sie müssen spüren, dass ich sie ernst nehme und dass ich sie mag." Denn der Kern des Extremismus-Problems, da ist er überzeugt, ist kein religiöses, sondern ein soziologisches: "Die Kinder haben hier in Deutschland noch kein Wir-Gefühl, keine innere Heimat gefunden."Schulleiter Finke sieht das ähnlich. Klar seien er und seine Kollegen für religiösen Fundamentalismus sensibilisiert. Es gibt extra einen Leitfaden, um eine Radikalisierung früh zu erkennen: Wenn jemand die Klassenfahrt schwänzt, seine Schwimmsachen oft vergisst, plötzlich ganz still wird. Aber mindestens genauso wichtig sei, der Verheißung des muslimischen Paradieses eine dem Leben zugewandte Pädagogik entgegenzusetzen.
"Die Kinder erfahren die Leistungsgesellschaft nicht als positiv. Die meisten Familien leben von Sozialleistungen. Wenn die Eltern ihre Kinder anmelden, lassen wir die Neunjährigen ihren Traumberuf malen." Sie sollen weg von den schönen Frauen, die im Himmel warten, und einen Traum für das Diesseits entwickeln. Dabei würden auch die engagierten Debatten im Unterricht von Aziz Fooladvand helfen. "Ihr seid keine Opfer. Ihr könnt aus den Verhältnissen raus", sei das Mantra der Schule.
Drei Jahre hat Fooladvand Zeit, um seine Schüler auf die Welt draußen vorzubereiten. Sie immun zu machen gegen das Werben der Salafisten. Fooladvand will, dass sie "koranisch argumentieren lernen", wenn etwa ein Bekannter plötzlich dafür schwärmt, für den IS in Syrien zu töten. Seine zehnte Klasse ist auf einem guten Weg. Gerade steht auf Fooladvands Unterrichtsplan: "Was mache ich, wenn sich ein Bekannter radikalisiert". Die Schüler diskutieren eifrig. "Hier, ich habe die passende Sure gefunden", ruft Elyas triumphierend: "Wenn jemand einen Menschen tötet ... so soll es sein, als hätte er die ganze Menschheit getötet", liest er vor. Fooladvand nickt zufrieden.
