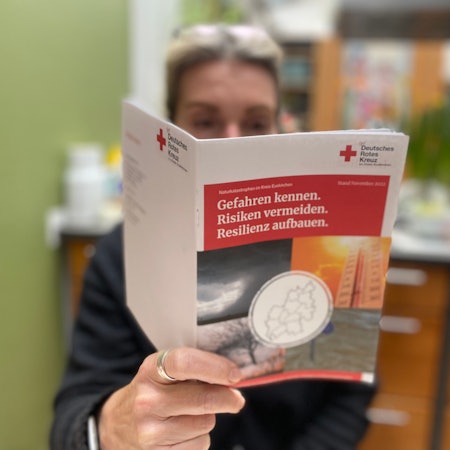80 Jahre nach Kriegsende standen Auswirkungen der sicherheitspolitischen Neuausrichtung beim Empfang von Landrat Markus Ramers im Mittelpunkt.
SchulterschlussWas die Zivil-Militärische Zusammenarbeit im Kreis Euskirchen bedeutet

Einblicke in den Bunker unter dem Kreishaus, inzwischen als Lager genutzt, hatte Hausmeister Wilfried Krebs vor einigen Jahren gegeben.
Copyright: Tom Steinicke
Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Seit 80 Jahren leben wir in Deutschland in Frieden. „Das ist trotz aller Krisen und Unzulänglichkeiten ein Geschenk, das wir schätzen müssen“, sagt Landrat Markus Ramers anlässlich seines Sommerempfangs im Kreishaus. Man war sich dieses Geschenks sehr sicher: Mit dem Ende des Kalten Krieges wurden Sirenen abgebaut, Bunker außer Betrieb gesetzt.
Spätestens seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine vor mehr als drei Jahren ist jedoch klar: Dieses Geschenks darf man sich eben doch nicht so sicher sein. Daher rückt Ramers an diesem sonst so heiteren Abend ein durchaus ernstes Thema in den Fokus, an dem auf vielen Ebenen gearbeitet wird und das im Ernstfall auch die Menschen im Kreis Euskirchen betreffen wird: die Zivil-Militärische Zusammenarbeit, kurz ZMZ.
Landrat will die Bevölkerung im Kreis Euskirchen sensibilisieren
Soldaten als Helfer sind im Kreis nicht neu. In der Corona-Pandemie haben sie bei der Kontaktpersonennachverfolgung und im Impfzentrum Unterstützung geleistet, nach der Flutkatastrophe mit zahlreichen Einheiten geholfen. Doch nun, das macht Ramers deutlich, ist es andersherum. Im Ernstfall geht es darum, wie die Gesellschaft die Streitkräfte unterstützen kann und muss, um etwa die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten oder logistische Aufgaben zu bewältigen: „Das sind Fragen, die müssen wir klären. Und die Bevölkerung muss sensibilisiert werden.“
Dabei gehe es weder um Kriegsrhetorik noch darum, Angst zu verbreiten. Stattdessen werden Szenarien durchgespielt, um im Ernstfall bereit zu sein – und es soll in der gebotenen Ernsthaftigkeit Verständnis geschaffen werden. Alle eint der Wunsch, dass derartige Pläne nie zum Tragen kommen. Doch unvorbereitet will man nicht sein. „Unabhängig von der großen Weltbühne“, so Ramers, werde auch im Kreis überlegt, wie die Sicherheit der Bevölkerung zu schützen und welcher Beitrag zu leisten ist.

Zum Sommerempfang hatte Landrat Merkus Ramers eingeladen.
Copyright: Tom Steinicke

Über die Zivil-Militärische Zusammenarbeit und deren Bedeutung für den Kreis sprachen Martin Fehrmann (l.) und Oberst Andreas Kubitz.
Copyright: Tom Steinicke
In einer Talkrunde mit Moderator Sebastian Tittelbach füllen Oberst Andreas Kubitz, Leiter des Zentrums für Cybersicherheit der Bundeswehr in Euskirchen, und Martin Fehrmann, Leiter der Abteilung Gefahrenabwehr beim Kreis, den eher sperrigen Begriff der ZMZ mit Leben. Sicherlich hätte der eine oder andere gerne erfahren, was denn genau im Operationsplan Deutschland steht. Darin sind für den Fall der Landes- oder Bündnisverteidigung Verfahren, Abläufe und Zuständigkeiten festgelegt.
Im Zuge der sicherheitspolitischen Neuausrichtung wurde der Plan entwickelt, und das nicht alleine von der Bundeswehr. Staatliche Stellen sind genauso einbezogen wie Blaulichtorganisationen und Wirtschaft. Es geht darum, „den Aufmarsch der alliierten Streitkräfte über und durch Deutschland an die Nato-Ostflanke sicherzustellen“, wie es bei der Bundeswehr heißt. Derartiges gibt das Militär bekannt – und mehr ist Oberst Kubitz dazu auch nicht zu entlocken: Das Dokument ist schließlich geheim.
Zusammenarbeit von Militär und Zivilisten auch im Kreis Euskirchen
Stattdessen verweist er darauf, dass die Soldaten als Teil der Gesellschaft sehr gerne helfen, wie in Corona und Flut geschehen. Doch das sei eben nicht das, wofür sie ausgebildet sind. Aktuell konzentriere man sich auf den Kernauftrag, und das sei der Kampfeinsatz, der in Ausbildung und Logistik enorme Kräfte binde.
Wir müssen die Bevölkerung in das Gesamtpaket einbinden und die Selbsthilfefähigkeit stärken.
Ohne Einblicke in den geheimen Operationsplan zu geben, vermittelt Kubitz eine Vorstellung davon, dass im Ernstfall auch der Kreis Euskirchen betroffen wäre. Ein Frontstaat werde Deutschland kaum sein, wohl aber eine Logistik-Drehscheibe. Und da braucht es keine überbordende Fantasie sich auszumalen, dass es längst nicht nur Job der Bundeswehr sein wird, wenn beispielsweise große Verbände bewegt werden: Straßen müssen vorbereitet und gegebenenfalls gesperrt werden, viele Fahrzeuge müssen unterwegs betankt, noch mehr Menschen verpflegt werden. Zudem müssen Plätze zur Unterbringung vorgesehen werden. Darüber hinaus ist all dies keine Einbahnstraße: Daher ist ebenso zu bedenken, dass Soldaten von der Front zurückkehren, Menschen auf der Flucht und Verletzte versorgt werden müssen.
Kubitz nennt Infrastruktur, Ausrüstung, Führungsfähigkeit und Selbstschutz als Stichworte. Noch deutlicher wird die Komplexität derartiger Planungen mit Blick aufs Personal: Es geht nicht um eine kurzfristige Aktion, die binnen weniger Stunden oder Tage abgearbeitet ist, sondern um eine 24/7-Einsatzfähigkeit über einen langen Zeitraum hinweg.
Die Lehren und Maßnahmen nach der Flutkatastrophe helfen nun
Dass die Denkrichtung nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, dass Bomben auf Deutschland fallen, und dass die Lage sehr komplex ist, machen Kubitz und Fehrmann deutlich. Die Bedrohung durch hybride Angriffe, Desinformationskampagnen und Cyberattacken sei täglich gegeben. Kubitz nennt ein Beispiel, das jeder kennt: E-Mails, in denen man aufgefordert wird, etwas anzuklicken – was ganz schnell großen Schaden anrichten kann. „Ohne Rückschlüsse auf unsere tägliche Arbeit zu geben“, sagt Kubitz: „Jede Mail ist auch heute ein potenzieller Angriff.“
Unabhängig von konkreten Bedrohungslagen verdeutlicht Fehrmann, wie bei den Verantwortlichen „in Phasen gedacht“ wird. So werde etwa in Friedenszeiten für den Katastrophenschutz geplant, der wiederum die Grundlage für den Zivilschutz im Verteidigungs- oder Bündnisfall ist und wobei es einige Schnittmengen gibt. Hier kommen dem Kreis Euskirchen aus der Flut gezogene Lehren zugute. Zum Beispiel in der Kommunikation: Nachdem damals die Funkverbindungen weitgehend ausgefallen waren, stehen nun darüber hinaus das Starlink-System und Satellitentelefone zur Verfügung – die für Katastrophen- wie Zivilschutz die Kommunikation sichern können.
Fehrmann macht aber auch unmissverständlich klar, dass sich etwas verändern muss. „Wir müssen die Bevölkerung in das Gesamtpaket einbinden und die Selbsthilfefähigkeit stärken.“ Dieser Punkt sei etwa seit den 1990ern verloren gegangen, da die Gewissheit geherrscht habe, dass es in Deutschland immer und für alles eine Stelle gibt, die hilft: „Die sind in Krisen aber nicht da. Dann muss man sehen, wie man sich selbst helfen kann.“
Der Bunker unter dem Kreishaus
Unter dem Kreishaus wurde bei dessen Bau ein Bunker angelegt. Geübt wurde darin für den Ernstfall, genutzt wurde er nie. Heute dient er als Lagerraum. Einer, der den Bunker kennt wie seine Westentasche, ist Wilfried Krebs. Er war fast 44 Jahre Hausmeister im Kreishaus.
Bis in den Keller der Kreisverwaltung muss man gar nicht vordringen, um Überbleibsel des Bunkers zu entdecken. Hinter dem Verwaltungsgebäude befinden sich beispielsweise zwei runde Betonkonstrukte, die mit einem Gitter versehen sind: Es sind Teile der ehemaligen Lüftungsanlage. Nur wenige Meter entfernt befindet sich eine große Metallplatte. Dort war über Jahrzehnte eine große Antenne installiert. „Da befand sich der sogenannte Kreis-Penis“, berichtet Krebs schmunzelnd: „Ein Sendemast, der ausgefahren höher als das Kreishaus war.“
Der Clou sei gewesen, dass der Raum verschüttungsfrei war. Selbst wenn das Kreishaus mit Bomben in Schutt und Asche gelegt worden wäre, seien – zumindest gemäß der Berechnungen, überprüft werden musste es glücklicherweise nie – keine Trümmer auf das Metalltor des Sendemastes gefallen. Mittlerweile ist der Mast laut Krebs abgebaut, den Raum gibt es aber noch.

Diesel sowie Trinkwasser wurden in den Tanks bevorratet.
Copyright: Tom Steinicke

Auf dem Stand der 1970er-Jahre ist die Technik im einstigen Kreishaus-Bunker.
Copyright: Tom Steinicke
Als Dienstautos und Fahrzeuge des Kreis-Bauhofs auf Diesel umgestellt wurden, wurde im Bereich der Tiefgarage eine Tankstelle installiert. Die wiederum sei an den Tank im Bunker angeschlossen worden, damit der Diesel in dessen Tank nicht alt wird. Mit Tankfahrzeugen sei der 32.000 Liter fassende Tank im Bunker aufgefüllt worden. Die großen Behälter, in denen neben Treibstoff auch Wasser eingelagert war, stehen noch immer im Bunker.
Andere Einrichtungen wurden im Laufe der Jahre deinstalliert, Duschen und Toiletten etwa. Den Tresor aber gibt es noch. Darin lagerten laut Krebs zu Hochzeiten des Kalten Kriegs unter anderem Essensmarken und Ersatzwährung. Beides wurde nie benötigt. Damit aber alles seine Richtigkeit hatte, kamen laut Krebs alle vier Jahre Mitarbeiter der Bezirksregierung zur Kontrolle vorbei. „Von denen war schon sehr lange keiner mehr da“, scherzt Krebs. Mit einem Gerücht räumt er auch auf: Der Bunker unter dem Kreishaus und der unter der ehemaligen THW-Liegenschaft am Jülicher Ring waren nicht miteinander verbunden.
Dass der Bunker künftig genutzt wird, wurde beim Empfang als sehr unwahrscheinlich bezeichnet. Alles sei auf dem Stand der 1970er-Jahre und nicht eben so nach aktuellen Erfordernissen herzurichten.
Die Empfehlungen des BBK
Denkbare Szenarien, dass das öffentliche Leben brach liegt und die Versorgung massiv eingeschränkt ist, gibt es genug: Naturkatastrophen etwa oder ein längerer Stromausfall. Hierfür gibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) Tipps, wie man daheim Vorsorge treffen kann.
Hamsterkäufe – Stichwort Toilettenpapier zu Beginn der Corona-Pandemie – sind damit genauso wenig gemeint wie blinder Aktionismus. In vielen Fällen hilft gesunder Menschenverstand. Und im Kreis Euskirchen sind die meisten Menschen aufgrund der Größe ihrer Wohnungen und Häuser in der Lage, entsprechende Vorräte anzulegen, wenn die nicht ohnehin stets vorhanden sind.
Einen Vorrat von zwei Litern Wasser und/oder Getränken pro Person und Tag sowie Lebensmittel für zehn Tage empfiehlt das BBK. In der Checkliste geben die Experten Beispiele inklusive der Kiloangaben. Wichtig bei Lebensmitteln ist, dass sie ohne Kühlung haltbar sind und nicht unbedingt gekocht werden müssen. Ebenso umfasst die Checkliste Dinge wie Kerzen und Taschenlampe, Campingkocher und Kurbelradio, die zuhause sehr hilfreich sein können.
Für einen Notfallrucksack gibt das BBK ebenfalls Empfehlungen, falls man sein Heim schnell verlassen muss. Erste-Hilfe-Material, Geschirr oder Hygieneartikel etwa können vorgepackt werden. Pass, Geld/Karten, Schlüssel und Handy haben ohnehin die allermeisten griffbereit.
Auch weitere Themen werden vom BBK behandelt: Was sollte in einer Hausapotheke sein? Wie wird eine Dokumentenmappe angelegt? Von Dach über Abwasser bis Elektroversorgung: Wie kann das Haus geschützt werden?
Die Listen mit den Empfehlungen sind auf den Seiten des BBK abrufbar.
Der Sommerempfang des Landrats
Zum Sommerempfang hatte Landrat Markus Ramers am Freitag eingeladen. Es war sein dritter – in den ersten beiden Jahren seiner Amtszeit hatte Corona das Kommando und solche Treffen waren undenkbar.

Rund 300 Gäste versammelten sich im Innenhof des Kreishauses.
Copyright: Tom Steinicke

Für die Musik sorgten unter anderem „Two of us“.
Copyright: Tom Steinicke
Bei lauem Sommerwetter trafen sich nun rund 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft sowie zahlreichen Vereinen und Institutionen im Innenhof des Kreishauses. Für Ramers ist die Zusammenkunft dieses Querschnitts der Gesellschaft ein Zeichen der starken Gemeinschaft und des Zusammenhalts, „wie wir ihn in diesen Zeiten vielleicht mehr denn je brauchen“.
Für den musikalischen Rahmen sorgte neben „Two of us“ das Jugendorchester des Musikvereins Sinzenich unter der Leitung von Andrea Cosman.