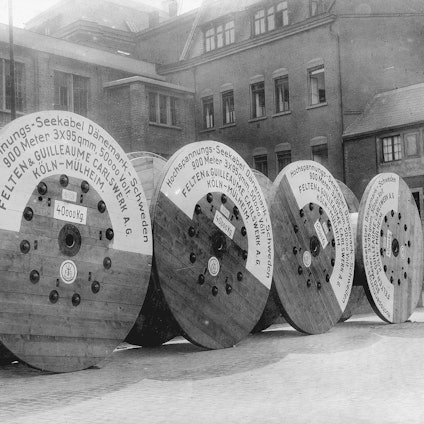Die Familie Stollwerck feierte mit ihrer Schokolade weltweit Erfolge. Das lag nicht nur an geschickten Investitionen, sondern vor allem auch an ungewöhnlichen Ideen.
Marken-SerieStollwerck-Schokolade machte Köln weltberühmt

Undatierte Aufnahme eines Werbewagens von Stollwerck in Köln.
Copyright: Schokoladenmuseum Köln
Schon 1959 sang die Kölnerin Trude Herr: „Ich will keine Schokolade.“ Der Park, der nach ihr benannt ist, steht genau neben dem Standort der ehemaligen Schokoladenfabriken von Stollwerck. Mehr als hundert Jahre ratterten hier im Kölner Severinsviertel die Maschinen, mahlten Kakaobohnen und gossen die flüssige Schokolade in Formen.
Der Gründer der Kölner Schokoladenfirma war ein geschäftiger Unternehmer. Bevor es Franz Stollwerck zur Schokolade verschlug, probierte er sich bereits an Lutschpastillen gegen Erkältung aus, eröffnete Cafés und Theater in Köln. Ab 1860 stellte er dann neben anderen Süßigkeiten auch Schokolade her. Zu Beginn produzierte er noch auf der Hohe Straße und in der Sternengasse, später zog das Unternehmen ins Severinsviertel, die Fabrik wurde als „Kamelle-Dom“ bezeichnet.

Stollwerck wurde mit seiner Schokolade weltweit bekannt.
Copyright: Leon Manz
Auch Stollwercks Söhne Heinrich und Ludwig stiegen in das Geschäft mit der begehrten Süßigkeit ein. Zwischenzeitlich eröffneten sie gar wegen Streitigkeiten mit ihrem Vater eigene Fabriken, führten die Unternehmen nach dem Tod des Vaters aber wieder zusammen. So konnte der Siegeszug der Kölner Schokolade nach Europa und in die USA beginnen.
Stollwerck stellte Schokoladenautomaten auf
Denn die Familie erkannte schnell die Trends der jeweiligen Zeit. Bei einem Besuch in den USA lernte Ludwig Stollwerck Münzautomaten kennen, in denen Händler Seife oder Zigaretten anboten. Er nahm die Idee mit zurück nach Köln und so testete Stollwerck Ende der 1880er Jahre kleine Schokoladenautomaten, die auf Verkaufstresen Platz fanden. Nachdem ein Kunde ein Zehn-Pfennig-Stück in einen Schlitz warf und an einem Knauf zog, fiel ein Stück Schokolade aus einem Loch.

Undatierte Aufnahme von Stollwerck-Mitarbeiterinnen bei der Produktion von Schokoladen-Osterhasen
Copyright: Schokoladenmuseum Köln
„Die Automaten waren ein bahnbrechender Erfolg“, sagt Andrea Durry, Kuratorin im Kölner Schokoladenmuseum. Mit der Zeit wurden die Automaten größer und standen nicht mehr auf dem Tresen, sondern waren so hoch wie Menschen. Mit vielen bunten Verzierungen lockten sie so die Kunden an. 1893 verkauften etwa 15.000 Automaten Stollwerck-Schokolade, davon standen alleine in New York 4000 Stück. „Um das Automatengeschäft entstand ein regelrechter Hype“, sagt Durry.
An einigen war ein Spiegel angebracht, ein cleverer Verkaufstrick: Spiegel hatten vor allem die wohlhabenderen Menschen zu Hause, das einfach Volk nur selten. Wer sich im Automaten betrachtete, kaufte dann im Anschluss vielleicht eine Schokolade, so das Kalkül. Es entstanden sogar Automatenhallen, auch auf der Hohe Straße in Köln. Hier konnten sich die Menschen an 80 Musik- und Schokoladenautomaten vergnügen.
Sprechende Schokolade
Ludwig Stollwerck kam auf immer neue Ideen. Zusammen mit dem US-amerikanischen Erfinder Thomas Edison entwickelte er etwas zuvor noch nie dagewesenes: die „sprechende Schokolade“ – Schallplatten komplett aus Schokolade. Die Schallplatten konnte der Käufer mit einem extra dafür gefertigten Grammophon abspielen. Durry vermutet: „Die Schallplatten mussten aus einer Art Bitterschokolade gefertigt sein.“ Die kleinen, dicken Platten konnten bis zu zehnmal abgespielt werden, etwa „Kommt ein Vogel geflogen“. Danach wurden sie gegessen.

So sah sie aus: die „sprechende Schokolade“ von Stollwerck.
Copyright: Leon Manz
Während der kommerzielle Erfolg der „sprechenden Schokolade“ ausblieb, konnten die Brüder mit Sammelbildern den Verkauf ihrer Schokoladentafeln ordentlich ankurbeln. Von Arbeitern auf Kolonien über preußische Soldaten bis hin zu exotischen Tieren war hier alles dabei. Für die Originalzeichnungen arbeitete Stollwerck mit renommierten Künstlern wie Emil Doepler oder Max Liebermann zusammen. „Viele Schulen nutzten die Tierabbildungen sogar für den Unterricht“, sagt die Kuratorin. Stollwerck gab die Bilder immer in Serien heraus. Das löste einen Hype ums Bildersammeln aus, erklärt Durry.

Die Sammelbilder wurden in Serien herausgegeben. Hier, im Sammelalbum Nummer 4, wurden exotische Tiere zusammengetragen.
Copyright: Leon Manz
Die bedeutendste Erfindung der Familie Stollwerck kam laut Durry aber nicht von Ludwig Stollwerck, sondern von seinem Bruder Heinrich. Schokoladenliebhaber bekommen von ihr zwar wenig mit, doch Hersteller nutzen sie noch heute: den Fünfwalzenstuhl. Dieser zerkleinert die Kakaomasse besonders stark. „Dieser Erfindung verdanken wir den besonderen Schmelz der Schokolade“, sagt Durry.
Maschinen aus der alten Fabrik bilden die Basis des Schokoladenmuseums
In den 1930er Jahren geriet die Firma auch wegen der Weltwirtschaftskrise ins Schlingern. Die Konkurrenz auf dem Schokoladenmarkt nahm mit den Jahrzehnten zu und Stollwerck verlor international an Relevanz, häufte hohe Schulden an und schrieb rote Zahlen. In den 1970er Jahren übernahm der Kölner Hans Imhoff die Aktienmehrheit an Stollwerck. Wenige Jahre später schloss er die Fabriken in der Südstadt und zog mit der Produktion nach Porz um.

Hans Imhoff bei der Eröffnung des Kölner Schokoladenmuseums
Copyright: imago stock&people
Während des Umzugs hatte Imhoff alte Maschinen verpacken lassen. Diese bildeten die Basis für ein Denkmal, das der Produzent der Stadt Köln hinterließ – das Schokoladenmuseum. Im Oktober 1993 öffnete es seine Pforten für Besucher und ist seitdem ein Besuchermagnet. Etwa 53 Millionen Mark investierte der damals 71-Jährige in den Umbau des Areals am Rheinauhafen. Der Schokobrunnen und die Ausstellungen ziehen mittlerweile jährlich mehr als 550.000 Interessierte an.
Nachdem Imhoff keinen Nachfolger in der Familie gefunden hatte, kauften und verkauften in den Folgejahren verschiedene Konzerne das Traditionsunternehmen. Diese kappten langsam die Kölner Wurzeln von Stollwerck. 2005 schlossen sie das Werk in Porz-Westhoven und auch die Kooperation mit dem Schokoladenmuseum ist beendet. Mittlerweile gehört Stollwerck zum belgischen Konzern Baronie. 2023 machte die Stollwerck GmbH einen Umsatz von rund 375 Millionen Euro. Zu den Marken, die Stollwerck produziert, gehören unter anderem Alpia, Eszet und Sarotti.
Seit die Investoren die Kölner Wurzeln des Unternehmens kappten, erinnert in der Stadt nur noch wenig an Stollwerck. Das Bürgerhaus Stollwerck suggeriert zwar namentlich einen Zusammenhang, befindet sich jedoch in einem Gebäude, das nie zur Fabrik gehörte. Einzig ein altes Maschinenteil erinnert an die Kölner Fabrik, aus der der Geruch geschmolzener Schokolade durch die Straßen im Severinsviertel wehte.