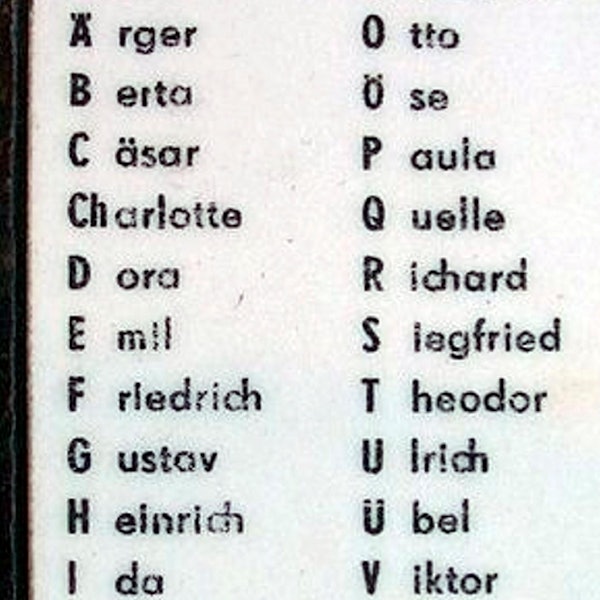Serie „Bridgerton“Jane-Austen-Welt mit People of Color – Ist das schon Fortschritt?

Adjoa Andoh als Lady Danbury und Regé-Jean Page als Herzog Hastings in „Bridgerton“
Copyright: Netflix
Zuerst ist es nur ein dandyhaft gekleideter Passant im London der Regency-Zeit, dann ein Diener in violetter Livree, ein rotberockter Gardesoldat und schließlich Sophie Charlotte zu Mecklenburg-Strelitz, Königin von Großbritannien und Irland: Sie sind zwar alle exakt so gekleidet, wie man es von Figuren in Jane-Austen-Verfilmungen erwartet. Aber sie fallen dennoch auf, werden sie doch von schwarzen Schauspielern und Schauspielerinnen verkörpert.
Die Serie „Bridgerton“, seit Weihnachten auf Netflix zu sehen, gilt schon jetzt als einer der größten Hits in der Geschichte des Streamingdienstes. Die Romanze um eine intrigenreiche Ballsaison im London des Jahres 1813 kletterte in 76 Ländern auf den Spitzenplatz der Top-Ten-Liste mit den meistgesehenen Shows. Der Erfolg kommt nicht unangekündigt. Bereits die Vorlage, Julia Quinns Zyklus historischer Liebesromane rund um die Bridgerton-Familie, erreichte Traumauflagen. Und für die TV-Adaption zeichnet mit Shonda Rhimes eine der renommiertesten Serien-Produzentinnen der USA verantwortlich.
Sie ist eine der wenigen Afroamerikanerinnen in dieser Position. Rhimes hat bereits ihre anderen Quotenrenner – „Grey’s Anatomy“, „Scandal“ – erfolgreich mit Hilfe von „color-blind casting“ besetzt. Einem Prozess, in dem Rollen „farbenblind“ ausgeschrieben und vergeben werden, also ohne die Hautfarbe oder Ethnizität der Schauspielerinnen und Schauspieler festzuschreiben, die für diese vorsprechen können.
Im britischen und amerikanischen Theater ist dieser Prozess weit verbreitet und wird nur noch selten diskutiert. Vor 20 Jahren spielte David Oyelowo („Selma“) in einer Produktion der Royal Shakespeare Company Shakespeares „Heinrich VI.“ und war damit der erste schwarze Schauspieler, der auf großer Bühne einen englischen König darstellte.
Drei Jahre zuvor hatte Patrick Stewart („Star Trek – The Next Generation“) das farbinverse Casting erfunden, um die Rolle des „Othello“ ohne Blackfacing spielen zu können: Sein „Mohr von Venedig“ war weiß, alle anderen Akteure schwarz. Eine höchst umstrittene Entscheidung. Nicht zuletzt, weil es sich als wenig erhellend erwies, einen weißen Feldherrn als Rassismusopfer zu zeigen.
In Lin-Manuel Mirandas Musical „Hamilton“, das 2015 am Broadway seine Premiere hatte, werden die Gründerväter der USA ausschließlich von „People of Color“ verkörpert. Das Ensemble, erklärte Miranda, solle so aussehen, wie das Amerika von heute. Kritiker bemängelten, dass weiße Sklavenhalter wie Washington, Jefferson und auch Hamilton selbst auf diese Weise allzu leicht entschuldigt werden.
Das könnte Sie auch interessieren:
Anders als auf der Bühne herrscht in den meisten Film- und Fernsehproduktionen der realistische Stil vor: Spider-Man mag die Gesetze der Physik verletzen, doch er schwingt sich durch ein wirklichkeitsgetreues New York und nicht durch einen leeren Raum, in dem Kreidezeichnungen die Häuser markieren (wie in Lars von Triers „Dogville“, der mit dieser filmischen Konvention spielt).
Auf Hautfarbe übertragen bedeutet das: Wenn Shonda Rhimes eine Krankenhausserie oder einen Politthriller farbenblind besetzt, ist die Diversität des Ensembles weniger augenscheinlich, denn sie verletzt ja nicht das Realismusgebot solcher Serien. Auch wenn das England der 1810er Jahre wohl ein wenig diverser aussah, als es in dutzenden, exklusiv weiß besetzten Austen-Verfilmungen gezeigt wird: Die farbenblinde Besetzung in „Bridgerton“ fällt nicht nur auf, sie soll auch auffallen.
Jahrhundertelange Benachteiligung
Insofern sollte man hier eher von einem „color-conscious casting“ sprechen, also von einem Besetzungsprozess, der sich der Hautfarbe der Darsteller nicht nur bewusst ist, sondern sie auch bewusst inhaltlich einsetzt. Zuerst einmal geht es um Fragen der Repräsentation. Fernziel des farbenblinden Castings ist es, die jahrhundertelange Benachteiligung nicht-weißer Schauspieler abzuschaffen. Die ist im Fall von Kostümdramen – ein wichtiger Exportartikel der englischen Unterhaltungsindustrie – eklatant: Das gesamte Genre war People of Color noch bis vor kurzem verschlossen. Als Dev Patel („Slumdog Millionär“), britischer Schauspieler mit indischen Wurzeln, vergangenes Jahr die Titelrolle in der Neuverfilmung von Charles Dickens’ „David Copperfield“ übernahm, galt das in jeder Kritik als bemerkenswerte Tatsache.
Shonda Rhimes hat sogar eine historische Begründung für ihre schwarze „Bridgerton“-Königin, gespielt von Golda Rosheuvel, gefunden: Angeblich war Sophie Charlotte zu Mecklenburg-Strelitz das erste Mitglied des britischen Königshauses mit afrikanischen Wurzeln, Jahrhunderte vor Meghan, der heutigen Herzogin von Sussex. Es gibt eine portugiesische Urahnin eventuell afrikanischer Herkunft, es existiert ein Gemälde des schottischen Porträtmalers Alan Ramsay, auf dem Charlotte tatsächlich als „mixed race“ durchgehen könnte.
Die Beweislage ist denkbar dünn, aber sie dient den Serienmachern als Ankerpunkt ihrer Fantasie: Wenn die Königin schwarz ist, könnten das auch andere Angehörige des Adels sein, wie die scharfzüngige Lady Danbury (Adjoa Andoh), oder Herzog Hastings (Regé-Jean Page), der meistbegehrte Junggeselle der Ballsaison.
Farbenblinde Castings
In Julia Quinns Romanvorlagen sind alle diese Charaktere weiß. Eine bedenkenswerte Kritik am farbenblinden Casting lautet, dass auf diese Weise dieselben weißen Geschichten immer weiter erzählt werden, nur leicht kosmetisch korrigiert.
Aber ist „Bridgerton“ überhaupt eine weiße Geschichte? Die Optik der Serie überzieht alles mit pastelligem Zuckerguss, und wenn die jungen Herren die jungen Damen im Ballsaal der Königin zum ersten Mal zum Tanz auffordern, spielt das Streichorchester ein zeitgemäßes Arrangement von Ariana Grandes Lobeslied der seriellen Monogamie: „Thank You, Next“.
Wir befinden uns eben nicht im Regency-London, sondern inmitten einer geistreichen, frivolen und kompromisslos kitschigen historischen Romanze. So ein Schmöker im Kostüm wird oft etwas abschätzig als reiner Eskapismus beschrieben. Doch vielmehr werden hier auf spielerische Weise Sitten und Gebräuche der Liebe verhandelt, nur eben nicht jene zu Zeiten des verrückten König Georg III., sondern solche von hier und jetzt. Die sind all-inclusive, oder sollten es wenigstens sein. Wäre „Bridgerton“ so porzellanweiß wie ein Jane-Austen-Roman, die Serie hätte ein echtes Problem.