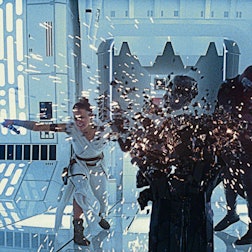Umstrittener Oscar-FavoritIst „1917“ zu schön für einen Kriegsfilm?

Im Schützengraben von „1917"
Copyright: dpa
Köln – Der Erste Weltkrieg wird oft als der erste Medienkrieg bezeichnet. Film und Fotografie entwickelten sich rasant, wurden zu wichtigen Mitteln der Propaganda und erlebten zugleich einen Siegeszug in eigener Sache: Auch wenn die Bilder vom Kampfgeschehen in aller Regel Nachstellungen waren, tat dies der Glaubwürdigkeitsbehauptung des Mediums keinen Abbruch.
Erst in den letzten Jahren haben imponierende Dokumentarfilme und Fotobände dieses visuelle Erbe zugänglich gemacht, sogar in 3D und Farbe. Noch immer fasziniert der ästhetische Überschuss, den der technische Pioniergeist bei den Kriegsfotografen freisetzte – etwa in den impressionistisch anmutenden Farbfotos im Autochromverfahren.
Der Film scheint aus einer einzigen Einstellung zu bestehen
Sam Mendes hat ihre pastellenen Töne in den ersten Einstellungen seines Kriegsfilms „1917“ zum Verwechseln nachgeahmt. Doch das ist lange nicht sein größtes Kunststück: Der ganze Film scheint aus einer einzigen, geschlossenen Kameraeinstellung zu bestehen. Auch wenn die Digitaltechnik das nötige Flickwerkzeug bereitstellt, ist diese fiktive Odyssee zweier junger britischer Soldaten durch die feindlichen Linien am 6. April 1917 von fast irrealer Perfektion. Ob beabsichtigt oder auch nicht: Auch hundert Jahre nachdem Siegeszug der nachgestellten Kriegsfotografie taugt der Große Krieg noch immer zum durchaus makaberen Augenschmaus.

Sam Mendes
Copyright: AP
Bereits ausgezeichnet mit dem Golden Globe als bestes Filmdrama, geht „1917“ mit zehn Nominierungen als einer der Favoriten ins Oscar-Rennen. Dabei dürfte die Branche vor allem beeindrucken, wie Mendes und der inzwischen 70-jährige Kameramann Roger Deakins mit ihrer selbst gewählten technischen Beschränkung umgingen.Auch wenn Alfred Hitchcock dieses Experiment nach seinem Pionierwerk „Cocktail für eine Leiche“ (1948) nicht mehr wiederholen wollte, reizt es noch immer manche Filmemacher zur Nachahmung. Während Sebastian Schipper 2015 in seinem echten „One-shot-movie“ „Victoria“ die performative Kraft der Unmittelbarkeit feierte, richtete László Nemes in seinem KZ-Film „Son of Saul“ den Blick weg vom Darstellbaren. Seine unscharfe Apokalypse ist der denkbare Gegenentwurf zu Sam Mendes’ hochpräzisem Virtuosenstück.
Das könnte Sie auch interessieren:
Es ist eine andere Art von fatalistischem Sog, den er mit seinem aufwendigen Hollywoodfilm anstrebt, ähnlich Steven Spielbergs „Saving Private Ryan“: Wieder gilt es, eine nahezu unmögliche Mission zu erfüllen. Die beiden britischen Soldaten Schofield und Blake sollen auf dem Höhepunkt des Krieges einen Fußmarsch durch feindliches Gebiet antreten, um eine Nachricht zu überbringen, die 1600 Kameraden retten könnte: Wenn ein Colonel nicht davon abgehalten werden kann, weiter vorzurücken, würde seine Kompanie in eine Falle der Deutschen tappen – darunter auch der Bruder des aufrichtigen und unbeirrbaren Blake.
Dean Charles Chapman spielt ihn mit einer fast naiven Entschlossenheit. Als das letzte Mal ein Epos aus dem Ersten Weltkrieg einen derart intuitiven Heldenmut feierte, ging er von einem Vierbeiner aus – „The War Horse“. Blakes Partner Schofield ist ein anderer Charakter, bei ihm sind es Sarkasmus und Zynismus, die eine gewisse Schutzfunktion erfüllen. Nun mag Vorsicht nach Shakespeares „Heinrich IV“ der bessere Teil der Tapferkeit sein, auf der Leinwand wirkt Überschwang meist doch deutlich heroischer. Und mit Pessimismus wurden erst recht keine Schlachten gewonnen.
Die einfache Geschichte wird zum Anlass für sentimentale Details
In der literarischen Aufarbeitung des Ersten Weltkriegs wurde die Desillusionierung zum bestimmenden Motiv; Mendes erinnert daran mit einem Zitat aus Remarques Roman „Im Westen nichts Neues“: „Wir haben so viel zu sagen, und wir werden es niemals sagen.“ Mendes entscheidet sich für das Gegenteil. Die einfache Geschichte wird zum Anlass für sentimentale Details und symbolistische Aufladung: Einmal findet Schofield in einer verlassenen Farm etwas Milch und kann damit nicht nur die Feldflasche füllen sondern später noch ein Baby füttern. Ein anderes Mal werden Erinnerungen an den Kirschgarten seiner Familie durch eine Szene irrealer Kirschblütenpracht an einem Fluss lebendig. Nicht, dass ein Kriegsfilm keinen Platz für Ästhetizismus ließe – Terrence Malicks „Der schmale Grat“ ist ein hervorragendes Beispiel –, doch Mendes’ Tableaus fehlt dieses Feingefühl. Unwillkürlich erinnert man sich an Kevin Spaceys feuchten Blütentraum in Mendes’ größtem Erfolg, „American Beauty“.
Mit emotionaler Wucht orchestriert er eine Heldengeschichte, die man schon 1917 hätte erzählen können. Zwar nicht mit solch handwerklicher Brillanz, aber doch mit ähnlicher Begeisterung für die Macht des Kinos, uns der „last minute rescue“ entgegen fiebern zu lassen, wie sie schon Filmpionier D. W. Griffith kultivierte. Dieser Film spielt nicht nur im Ersten Weltkrieg, er erinnert auch an die Propaganda, die ihn begleitete. Das klingt ungerecht, denn schließlich haben sich Schofield und Blake ihre Mission ja nicht ausgesucht. Aber genau deshalb sind sie ja die idealen patriotischen Helden – hineingeworfen in ein unmenschliches Drama geben sie Übermenschliches. Hundert Jahre nach seinem Ende scheint die Desillusionierung, die den Ersten Weltkrieg zum Thema zahlloser Antikriegsgeschichten machte, wieder der „großen Illusion“ gewichen: Wenn in den USA ein Präsident gerade erst einen politischen Mord befehlen konnte, hat auch der Krieg seinen Schrecken eingebüßt.
„1917“ ist für zehn Oscars nominiert und läuft in den deutschen Kinos.