Über Jahrhunderte hinweg war das Bild der Maria geprägt vom Frauenbild der Männerkirche: verzärtelt, idealisiert und gnadenlos verkitscht. Dabei hat die Weihnachtsgeschichte auch ganz anderen Stoff zu bieten.
LeitartikelDie Weihnachtsgeschichte ist auch eine unerhörte Provokation für das Patriarchat
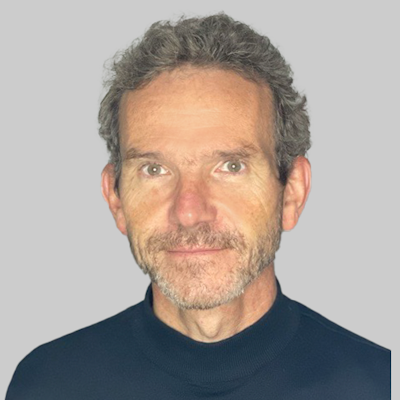

Krippenfiguren in einer Werkstatt in Bethlehem, dem biblischen Geburtsort Jesu
Copyright: afp
Ach, Maria! Im Krippen-Inventar und im traditionellen Liedgut zu Weihnachten hat die Mutter des „holden Knaben“ ihren zentralen Platz. Manche Werke der christlichen Kunst vermitteln bisweilen gar den Eindruck: Hätten die Maler oder Bildhauer sich für eine Figur entscheiden müssen, sie hätten Maria glatt den Vorzug vor dem Jesuskind gegeben.
Über Jahrhunderte hinweg war das Bild der Maria geprägt vom Frauenbild der Männerkirche: verzärtelt, idealisiert und gnadenlos verkitscht. Demütig und dienend sollte die Muttergottes der Kleriker sein, reine Magd und makellose Jungfrau – ein Fest für Tiefenpsychologen.
Dabei hat die Weihnachtsgeschichte auch ganz anderen Stoff zu bieten. Aber alles darin, was Unruhe in den Männerkosmos hätte bringen können, wurde unbewusst daraus verdrängt oder absichtsvoll ausgelassen.
Erstes Beispiel: Für das aus christlicher Sicht entscheidende Heilsereignis – die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus – braucht Gott in der Bibel die Männer nicht. Das ist der Clou der Jungfrauengeburt. Schwanger wird Maria nämlich etwa nicht von Josef, ihrem Bräutigam, sondern – vom Heiligen Geist. Wie auch immer man sich dann vorzustellen hat.
Eine unerhörte Provokation für das Patriarchat
Der Verkündigungsengel, den Gott mit dieser schwierigen Botschaft auf die Erde schickt, fragt in Nazareth nicht etwa bei Marias Vater oder bei ihrem Verlobten an, was sie von der ganzen Sache halten. Nein, Gott macht das einzig und allein mit Maria aus – eine unerhörte Provokation für das Patriarchat, damals wie heute.
In der Kirchengeschichte wurde das rasch und geräuschlos überdeckt. Maria sollte heilig sein, Mutter und Fürsprecherin – aber doch bitte kein Rollenmodell für Frauen, die in Kirche und Gesellschaft auf einer Stufe mit den Männern stehen wollen. Nur: Gottes Gerechtigkeit, die Maria im „Magnificat“ lobpreist, „gilt natürlich auch für Frauen“, wie die Theologin Julia Knop in ihrer Deutung der Weihnachtsgeschichte schreibt.
Heute, an Weihnachten 2022, gehört Maria deshalb klar auf die Seite all der Frauen, die im Iran und anderswo für ihre fundamentalen Menschenrechte, für Selbstbestimmung und Gleichberechtigung der Geschlechter kämpfen.
Ein zweites Beispiel für die subversive Kraft der Weihnachtsgeschichte: Im Lukas-Evangelium wird Maria schon kurz nach der Geburt Jesu mit den Spätfolgen ihrer Mutterschaft konfrontiert: Der greise Seher Simeon erkennt in Marias Sohn den von Gott gesandten Heiland. Dieser werde „ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen“, so prophezeit es Simeon in Vorwegnahme des Kreuzestods Jesu. Maria, das wird hier deutlich, ist auch die Leidtragende von Ungerechtigkeit, Machtwillen und brutaler Gewalt.
An den todbringenden Mechanismen einer von Männern dominierten Welt hat sich in 2000 Jahren wenig geändert. Als „Putins Version von Männlichkeit“ interpretiert der russische Historiker Alexey Tikhomirov den verbrecherischen Krieg Russlands gegen das Nachbarland Ukraine und die Menschen dort.
Deshalb gehört die Mutter Gottes heute klar auf die Seite der Ukrainerinnen und aller Frauen auf der Erde, wo von Männern angezettelte Kriege toben. Selten wies die Weihnachtsbotschaft Frauen und Männern so entschieden ihre Rollen zu wie in diesem Jahr. Und selten war die Verheißung vom „Frieden auf Erden“ so sehr auch ein Auftrag an alle „Menschen guten Willens“.

