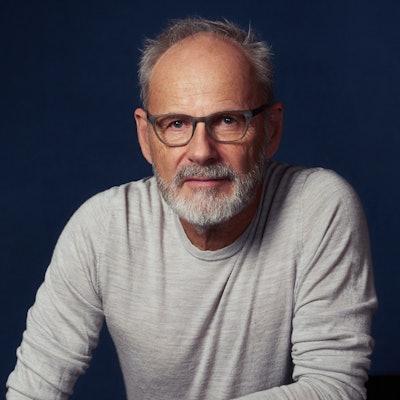Die Bundeswehr braucht mehr Personal, aber auch zivile Bereiche müssen gestärkt werden. Ein Gastbeitrag von Jörn Fischer.
Kölner PolitikwissenschafterEine Erklärpflicht für alle könnte die Lösung für Wehrdienst-Problem sein

Das Wehrdienst-Problem könnte eine Erklärpflicht für alle lösen. (Symbolbild)
Copyright: dpa
Die Koalitionäre feilschen um die deutsche Jugend. In der Arbeitsgruppe zur Verteidigungspolitik wurden Pläne für den Wehrdienst bewegt, im Bereich Jugendpolitik wurde besprochen, wie die Freiwilligendienste weiterentwickelt werden könnten. Sicherheits-, gesellschafts- und arbeitsmarktpolitische Überlegungen dominieren die Debatte. Die Bundeswehr braucht mehr Soldaten, die Gesellschaft braucht mehr Zusammenhalt, die Wirtschaft mehr Fachkräfte. Alles richtig. Aber was brauchen eigentlich die Jugendlichen?
Es ist Zeit, die Themen Wehrdienst und Freiwilligendienst zusammenzudenken – und dabei die Perspektive der Jugendlichen zu berücksichtigen. Ein übergeordnetes „Gesellschaftsjahr“ mit den Säulen Bundeswehr und Soziales, wie von der CDU als Pflichtdienst gefordert, ist allerdings unrealistisch, die politische Mehrheit für eine dazu notwendige Verfassungsänderung in weiter Ferne.
Jugendpolitisch ist eine Verpflichtung zu einem Dienst auch nicht besonders smart. Ob aber mit 100 Prozent Freiwilligkeit der Bedarf der Bundeswehr gedeckt werden kann, ist umstritten. Darf's also noch ein bisschen mehr Pflicht sein? Ja, darf es. Wenn die Jugend an anderer Stelle auch ein Recht bekommt.
Erklärpflicht soll Jugendliche zur Reflexion anregen
Das von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vorgeschlagene Wehrdienst-Modell sah vor, dass alle männlichen Jugendlichen einen Fragebogen ausfüllen müssen, aus deren Antworten die Bundeswehr Eignung und Motivation für einen Wehrdienst herauslesen will. Diese „Antwortpflicht“ der jungen Männer könnte weiterentwickelt werden zu einer Erklärpflicht für alle Jugendlichen: Bin ich bereit, einen Dienst an der Gesellschaft zu leisten? In der Bundeswehr oder in einem der bestehenden Freiwilligendienste?
Die direkte Konfrontation mit dieser Frage würde bei den Jugendlichen selbst, in ihren Familien und auf den Schulhöfen des Landes einen Reflexions- und Diskussionsprozess auslösen. Um die Entscheidungsfindung zu unterstützen, könnte eine verbindliche Beratung eingeführt werden – ein Vorschlag, den zuletzt Caritas-Präsidentin Eva Welskop-Deffaa in einem Brief an die Koalitionsverhandler ins Spiel gebracht hat.
Kaserne oder Krankenhaus, Katastrophenschutz oder Kulturzentrum? Im Ergebnis könnte eine passgenaue Freiwilligkeit stehen, von der Bundeswehr und Freiwilligendienste gleichermaßen profitieren. Sie stünden zwar in produktivem Wettbewerb zueinander, was Attraktivität und Rahmenbedingungen des Dienstes betrifft. Aber den Jugendlichen sollte das recht sein. Vielleicht finden so ja auch mehr Frauen den Weg in die Bundeswehr? Die Gesellschaft profitierte in jedem Fall, denn beide Formen des Dienstes werden gebraucht.
Alle müssen können
In puncto Freiwilligendienst fordern Verbände und Freiwillige selbst schon länger einen Rechtsanspruch. Das Ziel: Alle müssen können. Wer einen Freiwilligendienst wie etwa ein Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr, einen Bundesfreiwilligendienst oder einen Dienst im Ausland, etwa im Programm „weltwärts“, leisten möchte, muss dafür auch die Möglichkeit bekommen. Und zwar zu auskömmlichen Bedingungen.
In Zeiten, in denen gerade benachteiligte Jugendliche Schwierigkeiten haben, eine Einsatzstelle zu finden oder ihren Lebensunterhalt während des Freiwilligendienstes zu finanzieren, wäre ein Rechtsanspruch zu fairen Bedingungen ein Instrument der Teilhabe und Chancengleichheit. Der Bund könnte ihn trotz des föderalen Dickichts zwischen Bund und Ländern gesetzlich verankern. Eine Verfassungsänderung wäre dafür nicht erforderlich. Zu diesem Schluss kommt ein Rechtsgutachten der Bertelsmann-Stiftung.
Ein gegenseitiges Geben und Nehmen
Warum also nicht die beiden bislang eher separat diskutierten Ansätze miteinander verknüpfen? Eine Kombination aus Erklärpflicht und Rechtsanspruch auf einen Freiwilligendienst wäre ein gegenseitiges Geben und Nehmen, das die Beziehung zwischen den gerade erwachsen werdenden Bürgerinnen und Bürgern und „ihrem“ Staat nicht einseitig belastet.
Die Einführung einer Erklärpflicht würde kompensiert durch einen Rechtsanspruch auf einen Freiwilligendienst. Der Vorschlag wäre auch geschlechtergerecht, da er sich an Frauen und Männer gleichermaßen richtet. Aber vor allem jugendpolitisch wäre er ein ausbalanciertes Signal: Der Staat verpflichtet nicht nur, er ermöglicht auch.