Der Norden Kenias ist geprägt von nomadischer Lebensweise und bitterer Armut. Besuch bei zwei weiterführenden Schulen für Mädchen und Jungen, unterstützt von der Alfred-Neven-DuMont-Stiftung.
Reportage aus KeniaWo die Schule ein Ort der Rettung ist

Sprint zur Schulküche: Die freie Mahlzeit ist für viele Kinder ein wichtiger Grund, die Schule zu besuchen. Sie kommen aus armen Familien.
Copyright: Boniface Kirera
Die jungen Frauen sind Muslima – wie viele Menschen im Norden Kenias. Anfangs begegnen sie dem deutschen Journalisten zurückhaltend. Doch dann kommt Florence Mwangi hinzu, lokale Mitarbeiterin von Malteser International (MI) aus Köln. Sie stammt aus Nairobi und erklärt, warum wir uns hier an der Grenze zu Äthiopien befinden und was die Aufgabe des Journalisten ist: den Leserinnen und Lesern zu vermitteln, wie herausfordernd das Leben für die Menschen zum Beispiel in Kalacha ist, einem Ort im Marsabit County, der größten Provinz des ostafrikanischen Landes. Sie ist von einer trockenen, wüstenähnlichen Landschaft geprägt und wird mehrheitlich von Hirtenvölkern bewohnt. Diese ziehen mit ihren Herden dorthin, wo Gras wächst.

Die Kinder kommen aus armen Familien.
Copyright: Boniface Kirera
Das kann heute in Kenia sein, morgen in Äthiopien. Warum sie zur Schule gehen, fragen wir Forole und Barnesa, beide 17 Jahre alt. Aus deutscher Perspektive lässt die Antwort aufhorchen. „Weil wir dort sicher sind“, erklären die jungen Frauen. Das Internat schützt sie vor Zwangsehen mit älteren Männern und vor Genitalverstümmelung – einer grausamen Praxis, bei der mit Glasscherben die äußeren Geschlechtsmerkmale entfernt werden. Außerdem gibt es dort drei Mahlzeiten am Tag und damit keinen Hunger. Erst an vierter Stelle nennen sie Bildung als Grund für den Schulbesuch.
Ich will Arzt werden, um Geld zu verdienen und meine Familie zu unterstützen
In dieser Region, geprägt von nomadischer Lebensweise, kann Schule ein Ort der Rettung sein, wie eine resolute Schulleiterin es ausdrückt. Auf dem Land hingegen sind mitunter Traditionen und Bräuche noch so mächtig, dass sie das Leben von jungen Frauen massiv beeinträchtigen. Zwei weiterführende Schulen gibt es in Kalacha. Eine für Mädchen, eine für Jungen. Sie stehen am Beginn des Entwicklungsprojekts „My Healthy School“, „Meine gesunde Schule“. Dahinter steht ein ganzheitliches Konzept von Gesundheit, Ernährung und Umwelt sowie „Wash“ (Handwaschstationen, Hygiene- und Sanitärmaßnahmen). Gesundheit und Wohlbefinden der Lernenden sollen gefördert werden und auf deren Familien sowie umliegende Gemeinden ausstrahlen.
Die Alfred-Neven-DuMont-Stiftung, benannt nach dem verstorbenen Verleger des „Kölner Stadt-Anzeiger“, unterstützt das Projekt mit Malteser International. Dass der Weg zur Modellschule noch sehr weit ist, zeigt das Gespräch mit den jungen Frauen. Sie klagen über Wassermangel in ihrer Schule, zu der ein einfacher Schlafsaal gehört, der mit Etagenbetten vollgestellt ist. Häufig teilen sich zwei Mädchen ein Bett. Wenn sie ihre Menstruation haben, sei abends oft kein Wasser mehr zum Waschen da, vertrauen sie uns an. Zudem könnten ihre Eltern sich Monatsbinden einfach nicht leisten. Je länger man in der Region unterwegs ist, desto deutlicher tritt eine bittere Armut zutage, die alle Bereiche des Lebens umfasst. Fast jedes Gespräch endet mit der Feststellung, dass es an Geld fehlt. Das wird nicht wie eine Klage formuliert, sondern als nüchterne Tatsache. Die Region leidet extrem unter dem Klimawandel.

Warum Schule auch eine Rettung für junge Frauen ist, erläutern Forole und Barnesa im Gespräch mit dem Autor.
Copyright: Pacida
Die aktuelle Krise begann mit einer verheerenden Dürre vor drei Jahren. Kamele, Rinder und größere Tiere verdursteten. Durch einen Temperatursturz verendeten außerdem Hunderttausende Stück Kleinvieh. Die Region hat sich davon nicht mehr erholt. Bereits in den Vorjahren vernichteten Heuschreckenschwärme biblischen Ausmaßes das spärliche Grün. Das Klima ist hier extrem geworden. Überschwemmungen folgen auf Dürren, die Regenmuster verschieben sich. Kern der Region ist die Chalbi-Wüste, streckenweise übersät von vulkanischen Gesteinsbrocken. Geübte Einheimische, ob Mensch oder Tier, kommen hier leichtfüßig voran – Auswärtige dagegen kaum. Hin und wieder verschlägt es abenteuerlustige Touristen in die Region. Die karge Landschaft hat herben Reiz.
Die Nomaden mit ihrer traditionellen Kleidung setzen Akzente. Ihre Hütten – ein Geflecht aus Zweigen, über das Tücher geworfen werden – erinnern in ihrer Rundform an Iglus. In kurzer Zeit können sie ab- und andernorts wieder aufgebaut werden. Barako Guyo Jarso von der Jungenschule hat dieser nomadischen Welt den Rücken gekehrt. „Ich will Arzt werden“, sagt er auf die Frage nach seinem Berufswunsch. Eigentlich geht es ihm darum, Geld zu verdienen, um seine Familie zu unterstützen. Auch dieses Gespräch mündet im Thema Armut. Seine Eltern können die Schulgebühren nicht aufbringen, berichtet er. Umgerechnet sind das monatlich gut 20 Euro für Unterricht, Schlafplatz und drei einfache Mahlzeiten täglich – Getreidebrei, Bohnen und Mais. Er erzählt von der geschrumpften Herde, mit der seine Familie durch die trockene Landschaft zieht. Immer wieder stirbt ein Tier.
„Wir müssen ein anderes Leben führen“, sagt der 18-Jährige so eindringlich, als habe er die Unterlagen von „Meine gesunde Schule“ bereits gelesen. Tatsächlich ist ein Grundgedanke des Projekts, dass Schule und Schüler wie er den Anstoß zum Wandel geben – im dörflichen Umfeld wie in den Familien. Deshalb werden in der Schule Bäume gepflanzt, in deren Schatten Gemüsebeete angelegt, wird Grundwasser angebohrt, um große Tanks zu füllen. Zum Waschen, um Bäume und Beete zu bewässern, aber auch für benachbarte Siedlungen, um die Nachbarschaft zu stärken. Schulen sind auch zentrale Orte von Entwicklungsprojekten, weil sie in einer nomadischen Hirtenwelt, die ständig in Bewegung ist, Fixpunkte und Strukturen bilden.
Wenn in einem Land morgens die Cholera ausbricht, ist sie nachmittags beim Nachbarn
Hier erreicht man junge Menschen, vor denen noch ihr ganzes Leben liegt. Bereits eine tägliche Mahlzeit binde Kinder an eine Schule, berichtet ein Rektor. Das Essen sei nötig, da manche zu hungrig seien, um sich konzentrieren zu können. „Unsere Schulen liegen am Rand des Landes“, klagen Verantwortliche. Schulbücher kämen nicht, Zahlungen blieben aus, es fehle an Betten und Matratzen. Um sich Gehör zu verschaffen, seien sie mit anderen nach Nairobi gefahren, um dort zu protestieren. Dabei gilt Kenia der Weltbank heute nicht mehr als Entwicklungsland. Doch von einer positiven Entwicklung ist am äußersten Norden des Landes wenig zu spüren. Zwar steht am Turkana-See in Marsabit County der größte Windpark Afrikas.
Das kommerzielle Projekt Lake Turkana Wind Power (LTWP) liefert Strom für etwa 15 Prozent der kenianischen Haushalte – aber nicht für die Region selbst. Arbeitsplätze im Windpark sind hochspezialisiert, die Bevölkerung profitiert davon nicht. Geplant ist zudem eine Ölpipeline aus dem Südsudan, die durch Marsabit County ans Meer zur Insel Lamu führen soll. Doch auch hier sind die Nomaden allenfalls Betroffene, da die Rohre ihre Herden behindern. Immer wieder verweisen Fachartikel auf die weltweit besonders prekäre Lage der Nomaden in Nordkenia.
Wie wird die Lage im Jahr 2030 sein?, fragen wir Solomon Gubo, Vize-Gouverneur von Marsabit County. „Wir werden immer Tiere haben“, sagt er. „Aber wir müssen uns anpassen und stehen vor einer Welle von Herausforderungen. Dazu brauchen wir Hilfe von außen.“ Nachdrücklich betont er: „Es geht um unsere Art zu leben, unsere Kultur.“ Nicht an Grenzen oder Äcker gebunden zu sein und Weideflächen frei wählen zu können. „Eine Grenze ist für uns ein Nichts.“ Neben ihm sitzt Patrick Katelo Issacko, Vorsitzender der kenianischen Kamelzüchtervereinigung.
„Es gibt Menschen, die Nomaden für Barbaren halten“, sagt er nachdenklich. „Dabei war der biblische Stammvater Abraham ein Hirte, ebenso wie später auch Jesus.“ Seine Worte zeigen, wie tief verwurzelt die nomadische Lebensform seit Jahrtausenden ist und welchen kulturellen Identitätswert sie darstellt. Kurz zuvor war vom „plötzlichen Kamel-Tod“ die Rede – Tiere, die ohne ersichtlichen Grund verenden. „Es ist sehr schmerzhaft, ein Kamel zu verlieren“, sagt Issacko und klingt, als spreche er über einen Menschen. Gleichzeitig ist er Chef der regionalen Entwicklungsorganisation „Pacida“, die grenzüberschreitend in Kenia und Äthiopien arbeitet und vor Ort auch Projekte für Malteser International umsetzt. „Wenn in einem Land morgens die Cholera ausbricht, ist sie nachmittags beim Nachbarn“, erläutert der Vize-Gouverneur. Seine Verwaltung könne dann nicht tätig werden, „Pacida“ jedoch – mit Stützpunkten auf beiden Seiten – schon. Nicht weit von den Projektschulen in Kalacha betreibt Pacida eine Modellfarm.
Sie ist ein Gegenentwurf zum rein nomadischen Leben und will Alternativen aufzeigen. Gelehrt wird, wie Vieh gesund bleibt. Besser eine gesunde Ziege, die Milch gibt, als drei magere, kränkliche Tiere. Herden werden eingehegt, die Hirten lernen, Futter für die Tiere oder Gemüse für den Eigenbedarf und für lokale Märkte anzubauen. Was so einfach klingt, sind gewaltige Schritte. Abudho Borus Gesicht ist gegerbt von Wind, Sonne und Sand. Es ist von tiefen Furchen durchzogen und eingerahmt von einem traditionellen Tuch seines Volkes der Gabra. 60 Jahre ist er alt und berichtet, dass er dank des Projektes von Malteser International wisse, was Stallhaltung bedeute. Künftig wollen er und seine Mitstreiter Milch und daneben Produkte aus dem Gemüsegarten verkaufen. „Dann ruht unser Leben auf verschiedenen Säulen.“
Ob diese Rechnung aufgeht, fragt ein Gast. Aber genau hat das noch niemand nachgerechnet. Vielleicht deshalb werden die Frauen unruhig. Sie haben den Männern zugehört, die bei solchen Treffen den Ton angeben. „Vor uns liegen sehr große Schritte“, sagt eine. Es sei alles so neu. Sie bittet darum, das Projekt zu verlängern, um Begleitung zu haben. Das ist verständlich. Denn es sind die Frauen, die es richten müssen, wenn die Alternative keine Alternative ist.
Die Stiftung
Alfred Neven DuMont, der 2015 verstorbene Herausgeber des „Kölner Stadt-Anzeiger“, hatte die Stiftung, die seinen Namen trägt, wenige Jahre vor seinem Tod gegründet, um weltweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu fördern. Heute wird die Stiftung von seiner Tochter Isabella geführt. Überzeugt vom Projekt „Meine gesunde Schule“ hatte die Stifterin der ganzheitliche Ansatz, der Mensch, Tier und Umwelt einschließt sowie die Not der nomadischen Bevölkerung. Sie leidet unter einem extremen Klimawandel, den sie nicht herbeigeführt hat. (pp)
Der Autor
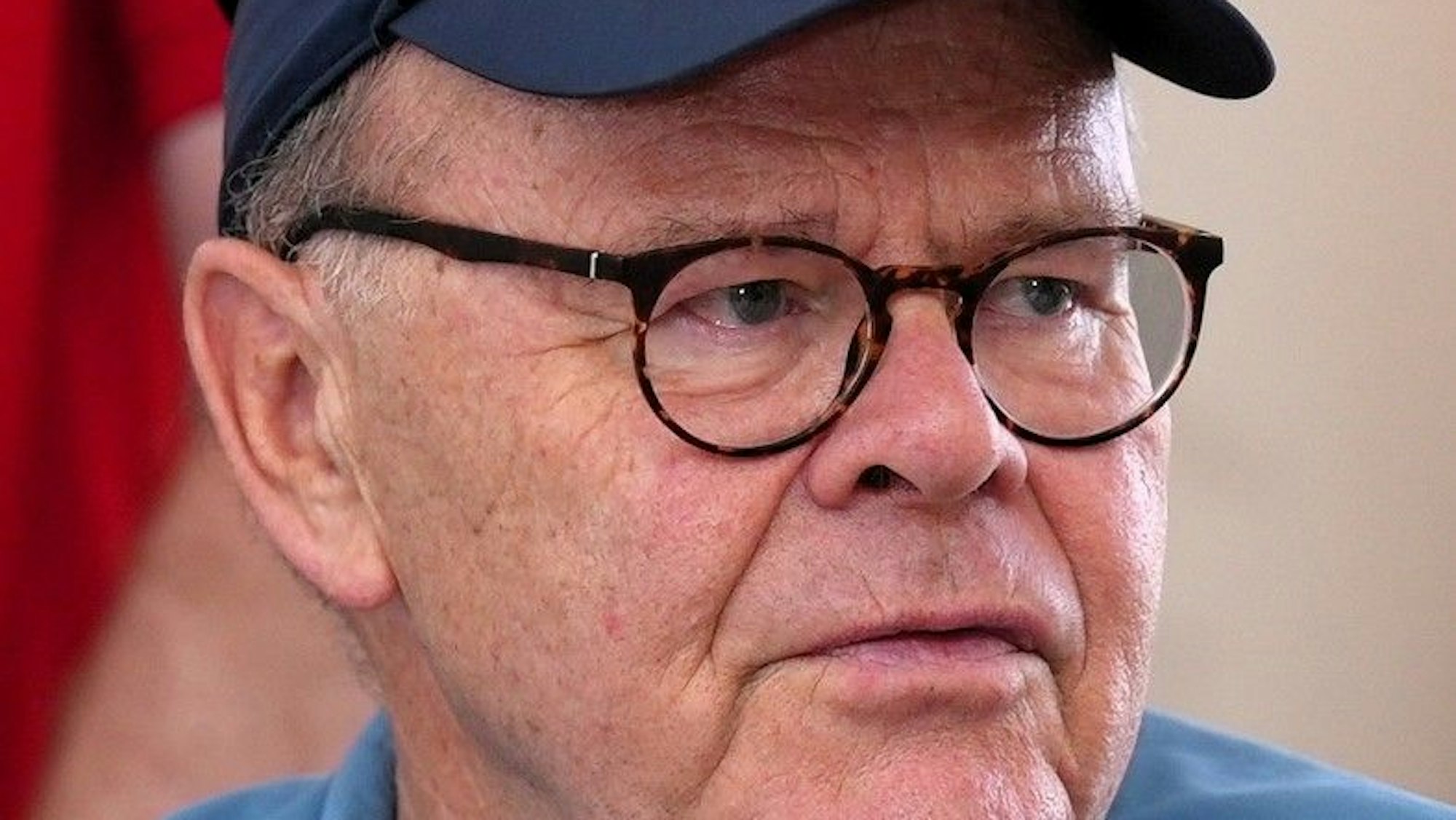
Peter Pauls
Copyright: Peter Pauls
Peter Pauls war von 2009 bis 2016 Chefredakteur des „Kölner Stadt-Anzeiger“. Davor arbeitete er unter anderem als Afrika-Korrespondent für verschiedene deutsche Zeitungen. Er ist Vorstandsvorsitzender des Kölner Presseclub.
