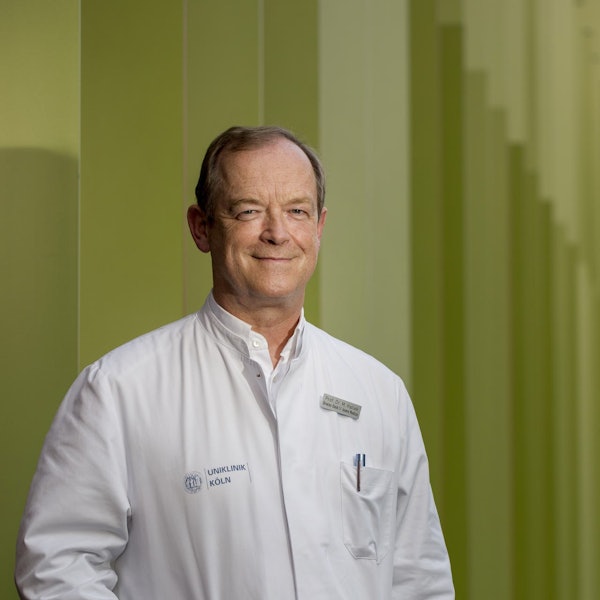Kölner Onkologe im Interview„Ich erlebe in meinem Beruf oft wahre menschliche Größe“

Prof. Dr. Michael Hallek ist ein deutscher Internist und Professor am Universitätsklinikum Köln.
Copyright: Michael Bause
Köln – Wer Onkologe wird, weiß, dass er gegen den Tod ganz oft verlieren wird. Trotzdem sind Sie Onkologe geworden. Warum?
Michael Hallek: Meine Berufswahl war nicht ganz einfach. Ich fand zwei Fächer spannend, die Neurologie und die Onkologie. In beiden gibt es noch ganz viele ungelöste Fragen, weiße Landkarten. Dann habe ich im praktischen Jahr als Student in der Onkologie gearbeitet und mit meinen ersten Patienten so eindrückliche Erlebnisse und Gespräche gehabt, dass mir schnell klar war, dass ich in dem Feld arbeiten möchte. Ursprünglich wollte ich Hausarzt werden in Oberfranken, wo ich herkomme. Ein Stückchen bin ich das auch jetzt, eine Art „Hausarzt“ für sehr schwer Kranke. Denn ich begleite sie über lange Zeit in vielen Lebenssituationen, manchmal auch sehr praktischen Lebensfragen, nicht nur medizinischen. Das entspricht mir sehr. Daneben ist es das mit Abstand dynamischste Forschungsfeld der Medizin zurzeit. Das fasziniert mich.
Hören Sie das ausführliche Gespräch mit Michael Hallek als Podcast.
Manche Ihrer Patienten ringen über Monate oder sogar Jahre mit dem Krebs und sterben am Ende dennoch. Wie halten Sie das aus?
Darauf habe ich mehrere Antworten. Die erste: Wenn Sie die Menschen erleben, die vor diesem Schicksal stehen, erleben Sie häufig wahre menschliche Größe und Schönheit. Das sind Menschen, die trotzdem nicht verzagen, die großzügig werden, wo die Traurigkeit, die man so unterstellt, komplett verschwindet. Ich erlebe natürlich auch ganz schlimme Situationen, wenn Familien viel zu früh getrennt oder die Angehörigen nicht mit dem Schicksalsschlag nicht fertig werden. Aber auch da bin gefragt als Arzt. Meine Tätigkeit ist also immer sinnvoll und nicht immer nur traurig. Zweite Antwort: Wir heilen heute deutlich mehr als die Hälfte der Patienten, das war früher anders. Dritter Punkt: Natürlich bin ich manchmal traurig, frustriert und müde. Ich kenne auch Kolleginnen oder Kollegen, die nach langer Zeit in der Onkologie erschöpft sind, die ausbrennen, wie wir sagen. Aber ich habe eine funktionierende persönliche Bewältigungsstrategie. Ich konnte vielleicht für den einen Patienten nichts mehr tun, aber ich kann für andere Patienten forschen. Wenn ich ins Forschungslabor gehe, kann ich mich umgehend wieder zurückzuholen in den Aktionsmodus.
Nehmen Sie die Trauer mit ins Private?
Wenn ich eine lange Woche in der Klinik hinter mir habe, dann kann ich am Freitagabend oft nicht auf eine Party gehen, umschalten und sofort Smalltalk machen. Das klappt dann nicht so gut. Ich habe das mal „Verernstung“ genannt. Ich brauche ein paar Stunden, bis ich wieder umschalte, bis ich ungezwungen und fröhlich wie alle anderen auch einfach mal über Blödsinn reden kann. Das gelingt mir am Samstag schon besser. Laut Erhebungen gelten aber Onkologen als sehr zufriedene Ärzte. Ich gehöre ganz bestimmt dazu, weil ich meinen Beruf als eine sehr privilegierte und sinnvolle Tätigkeit empfinde.
Es gibt ein lesenswertes Buch des Onkologen Siddhartha Mukherjee, „Der König aller Krankheiten“. Betrachten Sie den Krebs auch als König?
Ich finde das Bild nicht unzutreffend. Der Schock des Patienten, wenn hört, er hat Krebs, ist grundsätzlich größer, als wenn ich ihm erkläre, dass er verengte Herzkranzgefäße hat. Die emotionale Betroffenheit ist größer. Und das liegt neben der tödlichen Bedrohung auch daran, dass die Krankheit still kommt, manchmal unbemerkt und dass sie etwas Unheimliches hat, das schwer zu fassen ist. Gerade bei Blutkrebs ist es so. Wenn man sich eine heimtückische Krankheit ausdenken kann, die plötzlich zuschlägt und den Menschen verändert, dann ist es der Krebs. Wir forschen, um den König zu entmachten, ihm gewissermaßen die Kleider auszuziehen und ihn handhabbar zu machen. Das ist das, was mich antreibt.
Was für ein Verhältnis haben Sie zum Krebs? Ist er für Sie ein Feind, den es zu überlisten gilt?
Ich habe kein Bild für den Krebs als Krankheit, weil ich immer den Menschen sehe, den es betrifft. Der Krebs ist kein Feind, sondern ein Teil des menschlichen Lebens. Die Schönheit des Lebens ist ja zugleich bedingt durch ihre Endlichkeit. Wenn wir immer leben würden, würden wir vielleicht uns niemals richtig glücklich fühlen, wären gleichgültig gegenüber der Schönheit des Moments. Die endliche Existenz sollten wir positiv gestalten. Dabei kann sehr Krebs stören, und das würde ich gerne verändern.
Krebs ist in Deutschland mittlerweile die häufigste Todesursache. Liegt das daran, dass wir immer älter werden oder daran, dass wir die anderen Krankheiten besser behandeln können als den Krebs?
Letzteres. Wir überwinden immer mehr andere Krankheiten und kommen dann in das Alter, in dem wir Krebs erleben. Krebs ist eine Zellkrankheit, in den Zellen werden die Gene gestört. Das wird im menschlichen Körper für ein paar Jahrzehnte verhindert, etwa durch Zellreparaturprogramme. Aber wenn sich diese Programme dann er-schöpfen, zum Beispiel weil immer mehr Sonnenstrahlen auf die Haut gefallen sind oder Tabak in die Lunge geraten ist, dann gibt es rein statistisch mehr Mutationen und irgendeine dieser Genveränderungen wird nicht mehr repariert. Statistisch betrachtet passiert das umso häufiger, je älter man wird. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir den Krebs endgültig besiegen werden.
Warum ist Krebs so schwer zu behandeln?
Der wichtigste Grund ist, dass nicht ein Gen-Fehler gleich Krebs auslöst, sondern schätzungsweise mehr als zehn Fehler benötigt werden. Die müssen alle gleichzeitig in einer bestimmten Zelle auftreten, damit ein aggressiver Tumor daraus wird. Dass das eintritt, ist statistisch unwahrscheinlich und dauert eine gewisse Zeit. Krebs entwickelt sich also ganz langsam aus scheinbar kleinen Veränderungen. Diese Signalwege, die verschiedenen Interaktionen in der Zelle sind sehr kompliziert und entziehen sich teilweise immer noch unserem Verständnis. Es gibt aber hoffnungsvolle Ansätze. Je mehr Genfehler in der Zelle sind, desto stärker ist diese immunologisch auffällig und desto stärker kann man das Immunsystem gegen den Tumor steuern. Die Immuntherapie ist eine der größten Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte.
Als Laiin habe ich über Krebstumoren im Kopf: Wenn der Tumor noch nicht gestreut hat, ist das günstig, wenn er schon gestreut hat, wird es problematisch.
Diese Regel gilt immer noch. Ein Tumor, den man ganz einfach heraus operieren kann - im Gesunden, wie die Mediziner sagen - ist immer noch die beste Option. Die Chirurgie hat nach wie vor einen unverrückbaren, wichtigen Stellenwert in der Behandlung von Krebs. Die Operationsschritte werden immer besser, durch Robotik etwa. Erst, wenn das nicht mehr geht, weil der Tumor zu streuen droht oder schon gestreut hat, sind all die eben erwähnten Neuerungen wichtig. Ein metastasierter Tumor war früher fast ausnahmslos ein Todesurteil. Das ist es heute nicht mehr.
Die mRNA-Technologie, die das Pharmaunternehmen Biontech/Pfizer sehr erfolgreich gegen das Corona-Virus entwickelt hat, könnte auch gegen Krebs helfen. Wie viel Hoffnung setzen Sie auf diese Technologie?
Die mRNA-Technologie gehört zum großen Spektrum der immuntherapeutischen Möglichkeiten. Auf dem Feld erleben wir revolutionäre Erneuerungen und derzeit beinahe wöchentlich Studien, die bei einer anderen und neuen Krebsart den Wirkungsmechanismus dieser neuen Therapie zeigen. Mit mRNA wird versucht, die unterschiedlichen Genschnipsel in verschiedenen Tumoren zu erkennen. Darauf hat sich die Gruppe um Uğur Şahin in Mainz spezialisiert. Das ist das das eigentliche Forschungsgebiet schon seit Jahrzehnten. Die Komplexität ist aber sehr hoch. Für das Spike-Protein des Corona-Virus brauchte es ein Vakzin mit nur einem Molekül. Für jeden Tumor braucht es wahrscheinlich mehrere Moleküle, zehn bis zwanzig, damit die Immunisierung gegen Krebs wirklich funktioniert. Ob das so schnell gehen wird, bezweifle ich. Ich wünsche ihnen den Erfolg sehr. Die mRNA wird ein Baustein sein, aber nicht der einzige für die erfolgreiche Immuntherapie von Krebs.
Was wird in 20 Jahren möglich sein, was jetzt noch nicht möglich ist?
Wir machen derzeit große Fortschritte, bei manchen Tumoren sehr überraschend, bei anderen extrem geplant und systematisch. Ich forsche seit 30 Jahren an einer bestimmten Form von Leukämie. Vor 30 Jahren hatten wir ein Medikament, einige Jahre später zwei. Jetzt sind diese Medikamente bereits aussortiert, weil es Chemotherapien waren und wir heute mit gerichteten Substanzen behandeln. Wir sehen, dass die Lebenserwartung dieser Patienten immer weiter steigt. Eindrucksvoll ist die Forschungs-Geschwindigkeit auch beim schwarzen Hautkrebs. Als ich anfing, war diese Krankheit im metastasierten Stadium noch ganz schwer zu behandeln. Oder bei den Lymphomen gibt es tolle Fortschritte. Und bei vielen Patientinnen mit Brustkrebs hat sich die Prognose ebenfalls stark verbessert. Es bleiben aber große Herausforderungen. Bauchspeicheldrüsenkrebs zum Beispiel, oder Gallenblasenkarzinome. Ich hoffe stark, dass wir auch da in den kommenden Jahren durch besseres Verstehen der Tumorentstehung bessere Medikamente entwickeln.
Das könnte Sie auch interessieren:
Hilft die Digitalisierung der Krebsforschung weiter?
Unbedingt. Die Digitalisierung ist die Schlüsseltechnologie für den großen Fortschritt, den ich mir noch erhoffe. Das größte Entdeckungswerkzeug in der Krebsforschung zurzeit überhaupt ist die Verwendung großer Datensätze von Krebszellen und von Krebspatienten. Dieses kann eingesetzt werden zur Verbesserung der Therapie und für neue Einsichten in der Behandlung. Es gibt Antwort auf Fragen wie: Warum spricht der eine Patient auf eine Therapie hervorragend an und der andere Patient mit der gleichen Diagnose profitiert davon in keiner Weise? Aus großen Datensätzen können wir das lernen, inklusive der Information aus dem Tumorgenom. Das sind Terabytes an Daten. Nur als Beispiel: Das Gesamtgenom enthält so viele Buchstaben, dass ein Mensch dafür 50 Jahre lesen müsste. Dieses Wissen kann kein Mensch ohne digitale Hilfe verwerten. Also brauchen wir die Digitalisierung und es ist meine große Hoffnung, dass wir auch in Deutschland und in Köln sehr viel bessere Strukturen aufbauen, um Daten verwerten zu können.
Sie kritisieren, dass Innovationen in der Medizin oft aus China kommen, wie die Erkenntnisse aus Big Data, eben jener Auswertung riesiger Datensätze von Patienten, die bei uns unter anderem aus Datenschutzgründen oft nicht möglich sind. Was ist so schlimm daran, solche Erkenntnisse dann eben zu importieren?
Wenn wir konkret das Beispiel China nehmen, wäre mein erster Vorbehalt, dass es viele genetische Unterschiede gibt zwischen Asiaten und Europäern, die wir noch nicht verstehen, die aber einen riesigen Unterschied machen für die Krebsforschung. Aus ethischer Perspektive halte ich es auch nicht für sinnvoll, sich auf Daten zu verlassen, die unter Missachtung der Persönlichkeitsrechte erhoben worden sein könnten. Das sollte man verhindern. Der dritte Punkt ist der wirtschaftliche: Das wird man ja nicht umsonst bekommen. So zu tun, als würden Amerikaner und Chinesen zu je-dem Zeitpunkt, auf Wunsch quasi, alles zur Verfügung stellen, ist ein Traum, der sich niemals bewahrheiten wird. Wenn man mitreden möchte, braucht man eigenständige Lösungen. Und wenn man nicht mehr mitreden kann, wird man dafür zur Kasse gebeten. Schon jetzt wird die riesige Mehrzahl der neuen Medikamente in der Onkologie aus anderen Ländern importiert. Das kostet uns richtig viel Geld, während eigene Entwicklungen deutlich günstiger wären. Dass wir es prinzipiell immer noch können, hat Biontech mit der Corona-Vakzine gezeigt.
Der Datenschutz ist also ein großes Hindernis im Kampf gegen den Krebs.Ja. Wir müssen hier neu denken. Natürlich gehören die persönlichen Daten jedes Menschen geschützt. Es darf aber nicht sein, dass dieser Schutz am Ende tödlich ist. Ein Bei-spiel aus der Corona-Pandemie: Wenn wir gesellschaftlichen Konsens hätten herstellen können, die Kontaktnachverfolgung elektronisch zu machen, hätte das Tau-sende Menschenleben gerettet. Es will mir als Arzt nicht so recht in den Sinn, dass es dafür keine bessere Lösung gibt. Die meisten Patienten wollen, dass man ihre Daten für die Forschung verwendet. Ein Widerrufs-Recht dafür muss es natürlich geben. Wenn wir dafür keine kluge Lösung finden, werden die wesentlichen Erkenntnisse in Ländern erarbeitet, wo die Sicherheitsstandards deutlich niedriger sind, also etwa in China, aber auch in den USA. Es wäre gut, eine europäische Lösung zu haben. Ein großes Problem in Deutschland ist die heterogene unterschiedliche Rechtsauslegung in den Bundesländern. Wenn jeder Datenschutzbeauftragte in jedem Bundesland eine andere Interpretation des Datenschutzes hat, führt es bei bestimmten wissenschaftlichen Fragen oder Genehmigungsverfahren zu einem unfassbaren Mehraufwand mit zum Teil widersprüchlichen Empfehlungen. Diese Form von unprofessionellem Verhalten müssen wir verändern.
Künstliche Intelligenz ist in vielen Gebieten auf dem Vormarsch. Ist sie auch für Onkologie interessant?
Ja. Gerade bei großen Datensätzen, die ungeordnet sind und wo die gerichtete Programmiersprache nicht mehr funktioniert, kann man das System mit KI trainieren, selbst-ständig Lösungen zu finden und sich weiter zu verfeinern. Wir haben das hier in Köln schon bei Projekten angewandt.
Im Film sagt der Mann – meist ist es ein Mann – im weißen Kittel Sätze wie „Sie haben noch sechs Monate Zeit zu leben“. Sagen Sie das auch so?
Zwei Fernseh-Sätze würde ich gerne verbannen. Der Satz, den Sie genannt haben, gehört dazu. Die Frage nach einer verbleibenden Lebenszeit beantworte ich stets mit der Einschränkung: „Das kann ich nicht genau vorhersagen“. Natürlich kenne ich die Statistik und werde dem Patienten auch die Zahl nennen, mit dieser Information allein hätte ich mich schon oft geirrt. Eigentlich irrt man sich da immer. Wenn Patienten sich Jahre später noch erinnern, dass sie mal von ihrem Arzt eine bestimmte, Prognose mit einer genauen Zeitangabe vorhergesagt bekommen haben, halten sie das im Nachhinein für unseriös. Hilfreich kann hingegen sein, dem Patienten eine zeitliche Dimension zu nennen, die ihm als grobe Orientierung dienen können. Wir sprechen von Wochen, Monaten oder Jahren verbleibender Zeit – im statis-tischen Mittel. Der zweite Satz, den ich nicht gut finde: „Wir können jetzt nichts mehr für Sie tun“. Auch wenn wir keine Therapie gegen den Tumor mehr haben, können wir dem Patienten in tausendfach anderer Weise helfen, die letzten Schritte seines Weges gemeinsam gehen und die Symptome unter Kontrolle halten. Ein unheilbar kranker Patient braucht uns gerade in dieser Situation am meisten.
Kommt es vor, dass Sie Wunder erleben? Dass Patienten entgegen aller Wahrscheinlichkeit nicht sterben?
Richtig echte Wunder habe ich nicht in Erinnerung. Ich habe wundersame und wirklich erstaunliche Veränderungen oder Heilungen von Tumoren erlebt, von denen ich niemals gedacht hätte, dass sie passieren. Aber ich habe immer eine medizinische Erklärung dafür. Es gibt auch Tumoren, die einfach mal verschwinden, das gehört dann aber auch zu deren Natur.
Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich nicht an Krebs sterben wollen. Ich würde am liebsten plötzlich tot umfallen. Wie wünschen Sie sich Ihren eigenen Tod?
Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, so wie Sie – einfach fertig und tschüss. Wir beide können uns aber täuschen. Der Krebs hat auch eine Gnade: Sie können Abschied nehmen. In der Corona-Zeit haben wir oft das Gegenteil feststellen müssen: Da waren junge Menschen plötzlich intubiert und kamen nie mehr zu-rück, konnten sich nicht verabschieden von denen, die ihnen lieb und teuer waren. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich so antworte wie Sie: Ich weiß nicht, ob ich das in zehn Jahren auch noch so sage.