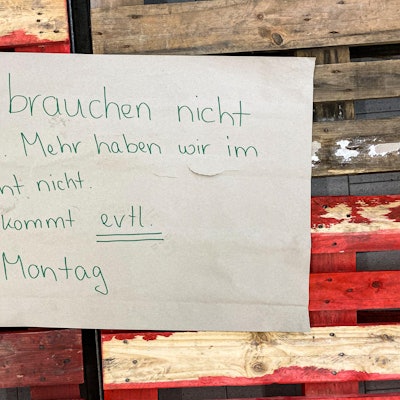Stephan Grünewald zur Corona-Krise„Auf einmal bekommt 'Weniger ist mehr' neuen Sinn“

Symbolbild
Copyright: imago images/Papsch
- Stephan Grünewald ist Geschäftsführer des Kölner „rheingold”-Instituts und schreibt im „Kölner Stadt-Anzeiger” häufig über seine psychologische Sicht auf die Gesellschaft.
- In diesem Interview spricht er über die Folgen des Coronavirus für die Gesellschaft und über das dramatische Wegbrechen vom vertrauten Alltag mit allen negativen – aber auch positiven – Begleiterscheinungen.
Herr Grünewald, als wir zuletzt miteinander sprachen, wiesen Sie darauf hin, dass eine vorsorgliche Quarantäne nicht nur als eine 14-tägige Gefangenschaft, sondern auch als eine urplötzliche Befreiung von den Zwängen des Alltags erlebt werden kann. War das zu idyllisch gedacht?
Wir sind jetzt in eine neue Phase eingetreten. Wir sprechen nicht mehr über eine zweiwöchige individuelle Vorsorgemaßnahme, sondern darüber, dass wir alle auf unbestimmte Zeit in eine Art kollektiven Vorruhestand geschickt werden. Der vertraute Alltag bricht dramatisch weg. Alles macht dicht, und wir werden aufgefordert, möglichst das Haus nicht zu verlassen. In dieser neuen Phase werden wir vielleicht ähnlich reagieren wie Rentner nach ihrem letzten Arbeitstag: Wir arbeiten erst einmal all das auf, was lange Zeit liegengeblieben ist: Akten sortieren, die Schränke aufräumen, den Wintergarten renovieren.
Wie lange, meinen Sie, trägt diese Phase?
Vielleicht zwei oder drei Wochen. Wenn alles abgearbeitet ist, treten wir in eine neue Phase ein, in der sich drei Strategien unterscheiden lassen. Die erste ist die Flucht in eine Tagtraumblase mit vielen Filmen oder einer Netflix-Serie nach der nächsten. Das schafft Ablenkung und vordergründige Erfüllung, führt aber auf Dauer zu größerer Unruhe. Sie kennen das vielleicht, wenn Kinder und Jugendliche zu lange auf der Playstation oder im Internet gedaddelt haben. Sie reagieren dann total überreizt, kriegen Trotz- oder Wutanfälle. Wer nur noch in der Blase oder im Echoraum unterwegs ist, neigt dann auch zu Verschwörungstheorien.
Das könnte Sie auch interessieren:
Also keine so vielversprechende Strategie…
Vor den Folgen der ersten schützt die zweite Strategie: den verloren gegangenen Reichtum des Alltags wiederentdecken, indem wir wandern, basteln, gärtnern, spielen, lesen oder miteinander reden. Auf einmal bekommt der Satz „Weniger ist mehr“ neu Sinn. Gerade durch die Stilllegung kann der Alltag eine neue Intensität gewinnen.Wenn darüber nicht diese Bedrohung namens Corona läge.
Die Bedrohung wird den Alltag in den nächsten Wochen überschatten. Aber sie birgt auch die Chance, das Leben wieder intensiver wahrzunehmen. Denn nichts ist mehr selbstverständlich. Jeder kennt das, wenn man von einem Besuch bei einem Schwerkranken heimkommt: Der vermeintlich graue Alltag hat dann auf einmal eine andere Tiefe und Farbe. Ja, es kann sein, dass wir uns mit Corona infizieren. Es kann sein, dass wir krank werden, vielleicht sogar liebe Menschen verlieren – aber wir gewinnen vielleicht neu die Empfindung für das Leben und für Werte, die sich mit der Zeit verflüchtigt hatten, weil wir irgendwie in einem Dauerparadieszustand waren.

Stephan Grünewald
Copyright: Henning Kaiser/dpa
Welche Werte meinen Sie?
Zum Beispiel, was es heißt, täglich eine warme Mahlzeit zu haben. Was es heißt, Zeit mit seinen Liebsten verbringen zu können.Strategie drei des Umgangs mit dem „kollektiven Vorruhestand”?
Der Moment, in dem wir aus unserer besinnungslosen Betriebsamkeit herauskommen, setzt eine darunter verschüttete Kreativität frei. Wir sind ja auch das Land der Ideen, der Dichter und Querdenker. Kreativität ereignet sich aber nicht im Turbomodus des Hamsterrads, sondern in Besinnungspausen. Jetzt eröffnet sich die Chance, aus der Zweckgebundenheit auszusteigen und uns auf uns selber zu besinnen. Das kann bestenfalls zu neuen Erkenntnissen und Ideen führen, wie wir leben und arbeiten wollen, und wie wir die Gesellschaft und die Wirtschaft umgestalten wollen.Wie solidarisch werden die Menschen in der Krise sein?
In unseren Untersuchungen haben wir festgestellt: Nie war die Solidarität größer als während der Hochwasser-Katastrophen. Da gab aber auch einen klar erkennbaren äußeren „Feind“, gegen den man sich gemeinsam wehren konnte. Jetzt haben wir einen unsichtbaren Feind, der tendenziell schon in jedem unserer Mitmenschen wohnen und uns anstecken könnte. Das ist eine hoch ambivalente Situation, in der die Impulse der Solidarität und des Selbstschutzes miteinander im Widerstreit liegen. Wir werden sicherlich in den nächsten Monaten in menschliche Abgründe blicken. Wir werden aber auch berührende Beispiele von Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft erleben.Und wie vermeidet man es, selbst zwischen Altruismus und Egoismus zerrissen zu werden?
Indem man eine Balance zwischen Anstand und Abstand findet. Zum Beispiel schon bei der Frage, ob wir in den Familien einander nicht mehr besuchen sollen, weil die Alten ja besonders gefährdet sind. Virologisch gesehen, ist es sinnvoll, den Kontakt vorübergehend einzustellen. Psychologisch gesehen, brauchen wir gerade in bedrängenden Situationen die Nähe zu den anderen. Gerade für die Alten sind Kinder und Enkel im Alltagsgefüge ein wichtiger Teil des Lebens. Deshalb müssen wir uns auch in Corona-Zeiten fragen, wie wir ein Zusammensein gestalten, bei dem die Ansteckungsgefahr möglichst gering, der Kontakt untereinander aber erhalten bleibt. Vorübergehend wird das wohl über Telefon, Whatsapp oder Skype gehen.