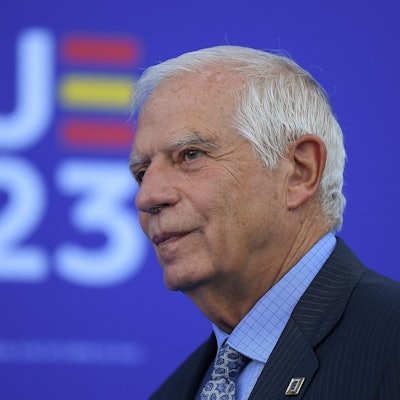An der tunesischen Küste warten verzweifelte Migrantinnen und Migranten nach oft jahrelanger Odyssee auf die gefährliche Überfahrt nach Italien. Europas Abschottungsversuche schrecken sie ebenso wenig ab wie die drastischen Maßnahmen der Tunesier.
Migranten in Tunesien„Was immer auch passiert, ich werde nach Europa kommen“

Reste eines Metallbootes im tunesischen Sfax, in dem Migranten von Tunesien nach Italien gebracht werden.
Copyright: Andy Spyra
Zweimal hat George bislang versucht, übers Meer nach Europa zu gelangen, zweimal ist der junge Mann aus dem westafrikanischen Liberia gescheitert: Im Januar und im Juli hat die tunesische Küstenwache die Boote abgefangen, mit denen der 21-Jährige und andere Migrantinnen und Migranten Kurs auf die italienische Insel Lampedusa nahmen. George hat sich dadurch nicht von seinen Plänen abbringen lassen, nach Deutschland zu gelangen.
Jetzt wartet er auf die Geldsendung eines Freundes aus Liberia, um den dritten Versuch bezahlen zu können – die Schulden werde er von seinem künftigen Verdienst in Europa zurückzahlen, sagt er. 500 Euro kostet derzeit ein Platz auf den Metallbooten nach Italien, die geschäftstüchtige Tunesier in der Gegend zusammenschweißen lassen.

Mohammad aus Guinea
Copyright: Andy Spyra
George harrt in einem Olivenhain nördlich der tunesischen Wirtschaftsmetropole Sfax aus, die sich wegen ihrer Nähe zu Lampedusa zu einem Sprungbrett für Migrantinnen und Migranten entwickelt hat. Zwischen den Bäumen haben sich einige Hundert Menschen zusammengefunden, der Landbesitzer lässt sie gewähren. Sie kampieren unter freiem Himmel, außerhalb der Sichtweite der Straße und einige Kilometer von der Küste entfernt. Die Migranten hier kommen aus Subsahara-Afrika, etwa aus Guinea, von der Elfenbeinküste oder aus Burkina Faso. Nur wenige Frauen und Kinder sind darunter. Jeder hier wartet auf einen Platz in einem der Metallboote nach Lampedusa.
Wichtigste Route geht von Tunesien nach Lampedusa
Die Route aus Tunesien nach Italien ist für Zuwandernde inzwischen die wichtigste geworden. Nach Angaben der europäischen Grenzschutzagentur Frontex vom vergangenen Monat hat sich die Zahl der illegalen Einreisen über das Mittelmeer aus Tunesien oder Libyen im Vergleich zum Vorjahr ungefähr verdoppelt. Inzwischen erreichen rund die Hälfte aller irregulären Einwandernden auf diesem Weg Europa. Die Zahl derjenigen, die über die Ägäis aus der Türkei oder über den Balkan kommen, hat dagegen deutlich abgenommen. Wer über das Mittelmeer nach Italien möchte, legte dafür in der ersten Jahreshälfte nach UN-Statistiken meist aus Tunesien ab – im vergangenen Jahr war es noch Libyen.
Die Menschen organisieren sich über soziale Medien wie Facebook, wie ein lokaler Journalist nördlich von Sfax erzählt. Sobald Gruppen von 40 bis 50 Personen zusammengekommen sind, kontaktiert ein Schlepper aus Subsahara-Afrika seinen Gegenpart auf der tunesischen Seite, der das etwa acht Meter lange Metallboot und den 40-PS-Motor stellt. Späher sagen Bescheid, wenn Polizei-Checkpoints unbemannt sind und die Luft rein ist, dann rasen die Pick-ups mit den Menschen und Laster mit Booten auf der Ladefläche aus ihren Verstecken zum Strand. Früher haben tunesische Schlepper die Boote gesteuert, die allerdings wegen Menschenschmuggel angeklagt wurden, wenn sie gefasst wurden. Daher haben sie die Aufgabe an Migranten ausgelagert, oft sind es frühere Fischer.

Die Küste nördlich der tunesischen Stadt Sfax. Von hier aus starten die meisten Migranten nach Italien.
Copyright: Andy Spyra
Bis das Startsignal kommt, warten die Menschen im Olivenhain. Nachts schlafen sie auf Kartons oder auf Plastikmatten, die sie auf den Sandboden legen. Tagsüber suchen sie Schutz im Schatten der Olivenbäume, unter denen ihre wenigen Besitztümer liegen: Schuhe, ein paar Kleidungsstücke, vielleicht noch Töpfe. Die Muslime unter ihnen haben auf dem Areal eine improvisierte Gebetsstelle mit Steinen abgesteckt und Matten nach Mekka ausgerichtet. Fast überall in der Umgebung liegt Müll. Leere Wasserflaschen häufen sich, Plastiktüten verfangen sich im Gebüsch. Gekocht wird über offenem Feuer, Holz liefert der Olivenhain reichlich. George lacht bei der Frage nach Toiletten. Man könne sich jeden Baum aussuchen, wenn der ein wenig Abstand zu den Schlafstätten habe, sagt er.
18 Stunden dauert die Überfahrt - wenn man ankommt
Nur rund 160 Kilometer sind es vom Strand aus bis nach Lampedusa, jener italienischen Insel, die in der EU zum Sinnbild für die Migrationskrise geworden ist und die im vergangenen Monat einen wahren Ansturm aus Tunesien erlebt hat. Für die Menschen in Sfax ist Lampedusa das Tor zum Traumziel Europa, das für sie am Ende einer oftmals jahrelangen Odyssee steht. Wenn das Wetter gut ist, wenn der Motor nicht streikt, wenn die Küstenwache nicht einschreitet, wenn die Bedingungen also stimmen, dann dauert die Fahrt übers Mittelmeer rund 18 Stunden.
Oft endet sie allerdings tödlich. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) werden seit 2014 mehr als 28 000 Migrantinnen und Migranten im Mittelmeer vermisst.
An diesem Spätsommertag erstreckt sich das Meer spiegelglatt bis zum Horizont, doch das Bild trügt. An einem Strand in der Nähe des Olivenhains finden sich die Überreste eines Toten, von dem nicht mehr viel übrig ist. Die Beckenknochen werden von einer Hose umschlossen, aus der unten Oberschenkelknochen und oben ein Teil der Wirbelsäule hervorragen. Kopf, Arme, Unterschenkel und Füße fehlen, was an den Hunden liegen dürfte. Von hier aus sieht man den Fischerhafen, in dem die Küstenwache Dutzende gestoppte Flüchtlingsboote aufgetürmt hat.

Gebetsteppiche in einem illegalen Camp in Sfax, Tunesien
Copyright: Andy Spyra
George sagt, er habe keine Angst. „Was immer auch passiert, ich werde nach Europa kommen“, betont der 21-Jährige, der ein buntes Hemd über seiner Hose und Socken in Badelatschen trägt. George lächelt die meiste Zeit, obwohl er eigentlich wenig zu lachen hat. Seine Geschichte gleicht der vieler junger Männer im Olivenhain: Der Vater stirbt – der von George fiel 2014 der Ebolaepidemie zum Opfer, wie er erzählt – irgendwann wird der älteste Sohn auf den Weg nach Europa geschickt.
Mit 13 oder 14 Jahren wurde der Sohn losgeschickt
Da ist etwa Mohammad aus Guinea, er ist 17 Jahre alt und trägt trotz der Hitze eine Wollmütze von Borussia Dortmund. Er sei BVB-Fan und habe die Kopfbedeckung irgendwann in Algerien gekauft, sagt er. „Ich wollte mein Land nicht verlassen, aber der Tod meines Vaters hat alles verändert.“ Mohammad weiß nicht mehr, ob er 13 oder 14 Jahre alt war, als er aufgebrochen ist. Was er weiß: „Wenn die Küstenwache uns stoppt, werde ich es natürlich wieder versuchen.“

George ist seit vier Jahren unterwegs.
Copyright: Andy Spyra
George sagt, er habe Liberia vor vier Jahren verlassen, damals war er 17 Jahre alt. Seitdem kämpft er sich in Richtung Europa vor. „Ich mache das, um meiner Familie eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Wenn in meinem Land bessere Zustände herrschen würden, würde ich das Risiko nicht auf mich nehmen.“ Für viele der jungen Männer kommen ein Scheitern und eine Umkehr nicht infrage – schließlich haben häufig ihre bitterarmen Familien allen Besitz zu Geld gemacht, um einen Hoffnungsträger nach Europa zu schicken.
Die Migranten nehmen dabei große Härten auf sich. Wasser und Essen gibt es im Olivenhain nicht. Die Menschen hier leben von der Hand in den Mund, arbeiten dürfen sie nicht. Im nahen Dorf El Amra gebe es vor einem Laden glücklicherweise einen Wasserhahn, den sie nutzen könnten, sagt George. Der Hunger ist damit nicht besiegt. Asis (30) aus Burkina Faso erzählt, er laufe täglich durch das Dorf, klopfe an Türen und bitte um Essen. „Das funktioniert aber nicht jeden Tag.“ Seit der zunehmend autoritär regierende tunesische Präsident Kais Saied die öffentliche Stimmung gegen die Migranten und Migrantinnen aus Subsahara-Afrika angeheizt hat, nimmt die Diskriminierung zu.
Auch Asis beklagt die Benachteiligung in Tunesien, er glaubt irrigerweise: „In Europa gibt es keinen Rassismus.“ Dabei steht Asis Europa wahrlich nicht unkritisch gegenüber. „Die Bodenschätze in meinem Land sind über Jahrzehnte von Europäern ausgebeutet worden, vor allem von Frankreich“, sagt er. „Hätten die Europäer für die Ressourcen einen fairen Preis bezahlt, dann wäre die Lage bei uns nicht so schlecht.“ Stattdessen habe die EU untätig dabei zugeschaut, wie Burkina Faso und andere Länder in Subsahara-Afrika in Elend und Instabilität abgeglitten seien.
Schwangere werden in der Wüste ausgesetzt
Die Bundesregierung hat einen härteren Kurs in der Migrationspolitik angekündigt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat am Dienstag ein „umfassendes Gesetzespaket für mehr und schnellere Rückführungen“ ins Kabinett eingebracht.
Die Europäische Union hat eine umstrittene Absichtserklärung mit Tunesien vereinbart, die im Wesentlichen beinhaltet, dass die autoritäre Regierung im Gegenzug für Finanzmittel Flüchtende auf dem Weg nach Europa stoppt. Dass dabei Menschenrechte eingehalten werden, hat die europäische Seite nicht zur Bedingung gemacht. Gruppen wie Amnesty International und lokale Nichtregierungsorganisationen wie das Tunesische Forum für Wirtschafts- und Gesellschaftsrechte (FTDES) werfen den tunesischen Behörden vor, die Menschen aus Subsahara-Afrika in die Wüste im Grenzgebiet zu Algerien und Libyen abzuschieben – und sie dort der Todesgefahr auszusetzen.

Khaled Tabbabi von FTDES kennt zahlreiche Fälle, bei denen Personen im Grenzgebiet zu Algerien oder Libyen ausgesetzt wurden.
Copyright: Andy Spyra
Auch George sagt, nach seinem ersten gescheiterten Lampedusa-Versuch seien er und 35 Mitreisende von den tunesischen Behörden in die Wüste im algerischen Grenzgebiet verfrachtet worden – ohne Essen, ohne Trinken, mitten in der Nacht. „In unserer Gruppe waren schwangere Frauen und Kinder“, sagt George. „14 von uns sind zurückgekehrt nach Tunesien. Ich frage mich, was mit den anderen geschehen ist.“ Auch sein Handy habe die Küstenwache ihm damals abgenommen. Die größte Angst der Migrantinnen und Migranten sei allerdings, nach Libyen abgeschoben zu werden. „Dort halten sie dich bis zu einem Jahr im Gefängnis, und sie schlagen dich jeden Tag und jede Nacht.“
Khaled Tabbabi von FTDES kennt zahlreiche Fälle, bei denen Personen im Grenzgebiet zu Algerien oder Libyen ausgesetzt wurden. „Tunesien ist nicht sicher für Migranten“, sagt er. Tabbabi ist überzeugt, dass die Abschottungsversuche Europas keinen Erfolg haben werden. Die Putsche in Afrika, die wirtschaftlichen Probleme und der Klimawandel würden zu massiven Fluchtbewegungen führen. „Die Migranten werden sich ihre Wege nach Europa suchen.“
In Sfax hat die Küstenwache zuletzt die meisten Boote gestoppt, die Statistiken des italienischen Innenministeriums zeigen einen Rückgang der anlandenden Flüchtenden. Tabbabi spekuliert, dass Präsident Saied den Europäern womöglich zeigen wolle, dass er die Migrationsströme kontrollieren und die Ventile je nach Belieben öffnen oder schließen könne – ähnlich wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.
Die Migranten im Olivenhain wollen sich von den schärferen Kontrollen der tunesischen Behörden nicht abhalten lassen. „Versetzen Sie sich in meine Lage“, sagt Asis. „Ihr Land wird von Terroristen angegriffen. Sie fliehen und sind jetzt in der Nähe der europäischen Küste. Natürlich werde ich bleiben, bis ich eine Möglichkeit finde, übers Mittelmeer zu gelangen.“ (RND)