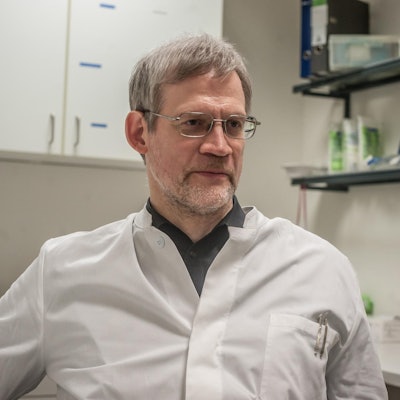Gedanken zum JahreswechselDie Welt im Krisenmodus

Blick in eine Covid-Intensivstation
Copyright: dpa
Köln – Was wird uns 2022, was wird uns überhaupt die nähere und fernere Zukunft bringen? Diese Frage werden sich zur aktuellen Jahreswende (nicht nur) viele Bundesbürger stellen, und sie dürfte in vielen Fällen weniger in Zuversicht als vielmehr in bange Erwartung getaucht sein. Diese Reaktion erscheint vorderhand berechtigt, denn es sind einfach zu viele Krisen und Konfliktlagen, die über sie hereinbrechen und denen sie sich als Einzelne wehrlos und ohnmächtig ausgesetzt fühlen. Und die, wiederum nachvollziehbar, tiefe Zweifel an der Problemlösungsfähigkeit von Individuen und Gemeinwesen wecken.
Die unbewältigte Epidemie mit völlig ungewissen Langzeit-Perspektiven, aber einer in ihrer Folge schon jetzt absehbaren tiefen Spaltung der bundesdeutschen Gesellschaft sowie die Erderwärmung, deren Konsequenzen ob ihres zeitlich versetzten Wirksamwerdens ebenfalls nicht abzusehen sind (obwohl uns die Überschwemmung des Ahrtals schon jetzt das Fürchten lehrt), markieren die Gipfel der ubiquitären Krisenlandschaft.
Aber es geht nicht nur um sie. Die sich verschärfenden internationalen Spannungen, die gleichfalls unbewältigte Flüchtlingskrise, die fortschreitende Zerstörung der Ökosphäre, der zusehends wirkungsvolle Angriff auf demokratische Lebensformen und Institutionen seitens autoritärer Populisten und offen rechtsextremer Kräfte in der nationalen wie der internationalen Arena, die Krise der europäischen Einigung, die persönlichen Sorgen um Arbeitsplatz, Einkommen und Alterssicherheit – die Aufzählung will kein Ende nehmen und verdichtet sich je nach dem zu einem emotionalen Komplex, der sich nicht nur als Krisenzeit-, sondern sogar als Endzeit-, wenn nicht Weltuntergangsstimmung beschreiben lässt.
Das könnte Sie auch interessieren:
Nun wäre unsere Zeit nicht die erste Epoche, in der es irgendwie endzeitliche – alternativ auch: apokalyptische oder millenarische – Breitengefühle gibt. Das Mittelalter und die frühe Neuzeit etwa sind voll von ihnen; immer wieder traten damals Propheten auf, die, oft mit genauer Datumsangabe, den nahen Weltuntergang ankündigten. In einer Zeit, da das Leben kurz und der Tod durch Hungersnöte, Seuchen (!) und Kriege allgegenwärtig war, lag so etwas auf der Hand. Die bevorstehende Katastrophe wurde dabei meist religiös instrumentiert: als Jüngster Tag eben, als Erscheinung des Antichrist, über den Christus als Weltenherrscher und -richter dann letztlich triumphieren werde.
„Im Säurebad der Aufklärung“ – dies die Formulierung des Historikers Johannes Fried –, unter dem Angriff von Kopernikanischem Weltbild und Newtonscher Physik lösten sich solche Visionen des Weltendes auf. Vorübergehend, denn mittlerweile kehrt – den Kindern der wissenschaftsgläubigen und -gestählten Moderne und unter deren Vorzeichen – der Weltuntergang als Denkform zurück.
Der Mensch braucht keinen Teufel mehr zum Untergang
Nur bedarf es jetzt keines Teufels und keines Gottes mehr – der Mensch und die von ihm geschaffenen Vernichtungskapazitäten schaffen die Apokalypse inzwischen ohne Zutun von Transzendenz. Die Vernunft sagt uns, dass wir im Begriff sind, den Ast abzusägen, auf dem wir sitzen. Und zugleich erkennt sie, dass sie selbst es war, die uns auf dem Pfad wissenschaftlich-technologischen Fortschritts an den Rand des Abgrunds geführt hat.
Nun gibt es zweifellos viele Menschen, die ungerührt und -beeindruckt durch die ostinaten Kassandrarufe, mit den Schultern zucken. Das allgemeine Lebensgefühl dieser Tage ist aber eindeutig ein anderes, und längst hat die Krisenterminologie auf die philosophische und gesellschaftswissenschaftliche Zeitdiagnostik übergegriffen. Vieles befindet sich heute in der „Krise“: der Kapitalismus, der Wohlfahrtsstaat, die Demokratie, die politische Legitimation, die staatliche Steuerungsmacht, der Nationalstaat und sogar, wenn man dem Soziologen Wolfgang Streeck folgt, sein Gegenteil: die Globalisierung.
Ein Buchtitel aus jüngster Zeit lautet, um nur dieses eine Beispiel zu nennen, aufschlussreich genug „Spätmoderne in der Krise“. Die Soziologen Andreas Reckwitz und Hartmut Rosa analysieren dort kontrovers und zugleich auf hohem gedanklichen Niveau die von ihnen als solche begriffene Krisenlage einer historischen Formation – der späten Moderne eben. Rosa beschreibt dort als Strukturmerkmal moderner Gesellschaften jenes Zusammenwirken von Wachstum, Beschleunigung und Informationsverdichtung, das allein, als „dynamische Stabilisierung“, die Fortexistenz dieses Modells garantiert.
Die globalen Ressourcen sind erschöpft
Die Synchronisation aber, so Rosa, kommt in unseren Tagen an ihr krisenhaftes Ende: Das betrifft nicht nur die globale Erschöpfung der natürlichen Ressourcen, sondern auch die humane Adaptionsfähigkeit. Die Fähigkeit der Individuen, den Dynamisierungsdruck produktiv zu verarbeiten, erreicht ihre Grenze. Nicht umsonst sind Burnouts und Depressionen in den den „Weltrhythmus“ vorgebenden westlichen Gesellschaften zu Volkskrankheiten geworden. Auch dies zeigt: Die Vorstellung von kollektiven oder persönlichen „Untergängen“ ist keine abstruse Spinnerei, sondern eine begründbare und begründete Reaktion auf reale Problemlagen.
Wie aber soll der ernüchtert-aufgeklärte Zeitgenosse, der sich bei Gelegenheit des Jahreswechsels vielleicht Gedanken über eine offene, auf jeden Fall aber bedrohliche Zukunft macht, mit ihnen umgehen? Eine Möglichkeit wäre, in der Erwartung, es werde schon nicht so schlimm kommen (more coloniense: Et hätt noh immer joot jejange), so weiter zu machen wie bisher. Dass diese Haltung, die Artur Schopenhauer einst als „ruchlosen Optimismus“ geißelte, dem, was auf dem Spiel steht, nicht gerecht wird, liegt auf der Hand. Sie ist zu verwerfen.
Schopenhauer war der herausragende Vertreter eines philosophischen Pessimismus, vielleicht legte er, wenn er heute lebte, die Hände in den Schoß in der Einsicht, dass der Zug in Richtung Katastrophe eh nicht mehr aufzuhalten sei. Diese Haltung wäre sogar verständlich, indes antwortete sein Zunftgenosse Jürgen Habermas, der seinerseits aus der tief-pessimistischen Frankfurter Schule kommt, einmal auf die Frage dieser Zeitung, was ihn von der Verzweiflung angesichts des schlechten Weltlaufs abhalte, mit dem Verweis auf Kant: „Verzweiflung ist unausdenkbar.“
Auch Hartmut Rosa „verzweifelt“ nicht, sondern beharrt auf dem Realismus einer freilich dringend erforderlichen Gegenstrategie: dass mit dem Modell der „dynamischen Stabilisierung“ radikal gebrochen werden müsse.
Tatsächlich könnte angesichts der kumulierenden Weltprobleme „alles zu spät sein“. Wenn wir allerdings aus einem falschen Optimismus oder Pessimismus heraus gar nichts tun, dürfte es auf jeden Fall zu spät sein. Herbert Achternbuschs „Du hast keine Chance, aber nutze sie“ beschreibt recht gut das zeitadäquate Handlungsparadox, dem sich die ratlosen Kinder der Spätmoderne auch an der Schwelle eines neuen Jahres ausgesetzt sehen.