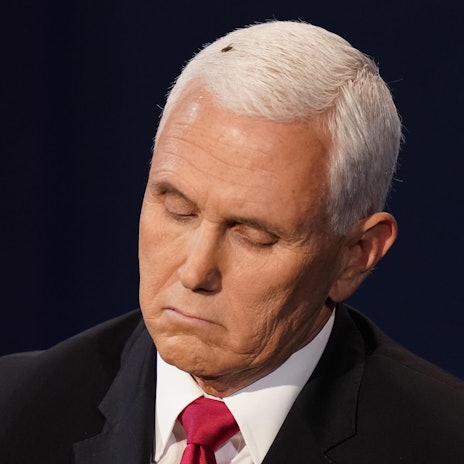Zur Besetzung symbolischer OrteVom Sturm auf die Bastille zum Sturm aufs Kapitol

1814 zündeten die Briten Washingtons öffentliche Gebäude an (hier eine anonyme zeitgenössische Darstellung). Damals brannte auch das alte Kapitol aus.
Copyright: Library of Congress
Köln – Nein, gebrannt hat das Kapitol in Washington am Mittwoch nicht. Es wurde vom aufgewiegelten Trump-Mob ein bisschen verwüstet, das war’s. Stunden später konnte der Kongress seine Beratungen unbeeinträchtigt an Ort und Stelle fortsetzen. Dabei hatte das Zentrum der amerikanischen Demokratie tatsächlich schon einmal gebrannt: im Jahre 1814, da im Zuge des britisch-amerikanischen Krieges die Rotröcke Washington besetzten und zahlreiche öffentliche Gebäude anzündeten. Das damalige Kapitol wurde zur Ruine, seine heute geläufige klassizistische Gestalt mit der krönenden Kuppel erhielt es erst in den folgenden Jahrzehnten.
Beide Ereignisse haben nicht viel miteinander zu tun
Ein Vergleich der beiden Ereignisse – weitere Gewalteinwirkungen auf den Komplex in der mehr als 250-jährigen Geschichte der US-Demokratie gibt es nicht – zeigt freilich, dass sie nichts miteinander zu tun haben. Während der Brand von 1814 sich einer „geregelten“ zwischenstaatlichen Auseinandersetzung verdankte, ist der jüngste „Sturm“ auf das Kapitol trotz seiner wohl überschaubaren materiellen Schadensfolgen ein ungleich explosiverer Konfliktfall. Die gewaltbereite Nicht-Akzeptanz von prozedural einwandfrei zustande gekommenen Wahlergebnissen seitens eines nicht unbeträchtlichen Teils der Bevölkerung verweist auf die Fortgeschrittenheit eines Zustandes, den die klassische Soziologie (Émile Durkheim, Talcott Parsons) als gesellschaftliche „Anomie“ zu bezeichnen pflegt: Die normativ-handlungsorientierenden Bindekräfte eines Gemeinwesens sind dabei in einem Maße erodiert, und die innerstaatlichen Feinderklärungen nehmen ein solches Ausmaß an, dass Bürgerkrieg droht – nicht immer ein heißer, aber doch, wie dieser Mittwoch zeigte, einer mit dem Potenzial einer entsprechenden Eskalation. Was ein Bürgerkrieg ist, das wiederum wissen gerade geschichtsbewusste Amerikaner: Er ist seiner Natur nach grausamer als jeder Staatenkrieg, weil er keinen Kompromissfrieden kennt, sondern nur die totale Niederlage einer der beteiligten Parteien.
Die Suche nach einem gemeinsamen Muster ist ergiebig
Führt somit der Vergleich der 1814er und 2021er Ereignisse nicht weit, so mag es sich mit Parlamentsbesetzungen in alter und neuer Zeit anders verhalten. In der Tat ist in diesem Zusammenhang die Suche nach einem gemeinsamen Muster unter dem Anomie-Aspekt ergiebig.Dem hiesigen politischen Beobachter fällt in dieser Hinsicht selbstredend sogleich der „Sturm“ auf das Reichstagsgebäude seitens aufgebrachter Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen der Politik im August 2020 ein. Sieht man sich die Bilder an, fallen die Parallelen zwischen Washington und Berlin ins Auge: hier wie dort eine aggressive Menge, aufgeputscht von Verschwörungstheoretikern, ausgestattet mit Fahnen (offiziellen und „illegalen“ wie Reichskriegs- und Südstaaten-Bürgerkriegsflagge) und bereit, eine überforderte Polizei zu überrennen.Das Ausmaß mag jeweils unterschiedlich sein, aber das Konfliktdesign ist das nämliche: Eine Bevölkerungsminorität spricht der gewählten Regierung des eigenen Landes die Legitimität ab, besetzt – real oder symbolisch, besser: realsymbolisch – das Zentrum der legislativen Macht, um damit die Durchsetzung einer eigenen, de facto zwar illegalen, von ihren Verfechtern aber eben als legitim angesehenen Agenda zu betreiben. Die (allerdings nicht nur versuchte, sondern auch erfolgreich-nachhaltige) Eroberung von machtsymbolischen Schlüsselorten – in der Französischen Revolution etwa der Bastille – ist übrigens, ganz unabhängig von Rechtfertigungsfragen, ein geläufiger Vorgang bei fundamentalen politischen Umbrüchen.
Eine etablierte Praxis im Machtkampf
In ungefestigten, in zerfallenden, in von Revolution oder Konterrevolution bedrohten Staatswesen – zu denen freilich weder die USA noch die Bundesrepublik zählen – gehören Parlamentsbesetzungen zu etablierten Praktiken im Kampf um die Machteroberung. Im April 2016 zum Beispiel stürmten wütende Demonstranten – Anhänger des radikal-einflussreichen regierungsfeindlichen schiitischen Geistlichen Muktada al-Sadr – das Parlament in Iraks Hauptstadt Bagdad, nachdem dort ein neuer Vorschlag für eine Expertenregierung abgelehnt worden war. Hunderte Menschen stimmten im Abgeordnetenhaus Sprechchöre an und schwenkten irakische Fahnen. Auch in den Sitzungssaal drangen sie ein und bedrohten die Parlamentarier.
Das könnte Sie auch interessieren:
Noch einmal zurück zum Berliner Reichstag und seiner Geschichte: Dem Reichstag widerfuhr tatsächlich, wenn auch in anderen Kontexten, dasselbe Schicksal wie dem Washingtoner Kapitol: Je einmal ging er in Flammen auf und wurde er besetzt. Beides geschah im Jahre 1933 – im Abstand eines guten Monats. In der Nacht auf den 28. Februar brannte das Reichstagsgebäude nach Brandstiftung aus. Die Frage nach der Urheberschaft ist bis heute nicht eindeutig beantwortet. Unstrittig ist allerdings, wem sie zugute kam: Sie begünstigte und beschleunigte den Prozess der NS-Machteroberung.Die Reichstagsbesetzung fand dann – am 23. März – naheliegend nicht mehr im Reichstagsgebäude, sondern im „Ausweichquartier“ der Krolloper statt. Die Besetzer waren SA-Horden, die die anwesenden, also noch nicht eingekerkerten Abgeordneten unter Druck setzten, dem von der Hitler-Regierung eingebrachten Ermächtigungsgesetz zuzustimmen. Was dann bekanntlich auch – gegen die Stimmen der SPD – geschah.Auch wenn Vergleiche aktueller Ereignisse mit der Nazi-Ära meist schief sind: Einschüchterung, Gewaltbereitschaft, Nötigung – all das hatte der stürmende Washingtoner Trump-Mob zweifellos ebenfalls in seinem Repertoire.