Um die Pisa-Ergebnisse zu verbessern, sollten Schulen entlastet, Schulpolitik stabilisiert und Kompetenzen von Bund, Ländern und Kommunen vereinheitlicht werden.
Leserbriefe zur Pisa-StudieForderungen nach mehr Geld reichen nicht
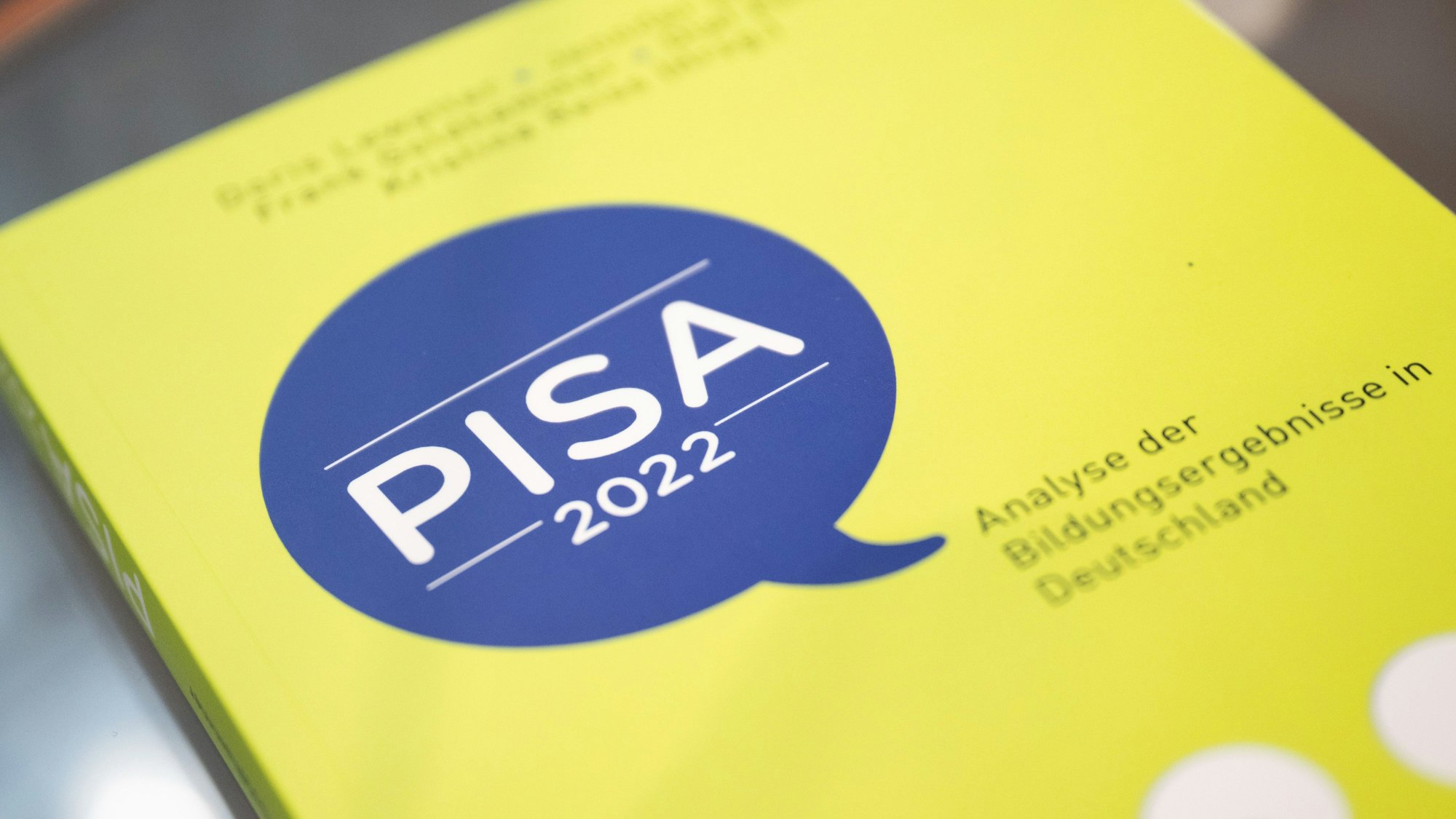
In der Pisa-Studie 2022 schneiden deutsche Schülerinnen und Schüler schlecht ab.
Copyright: dpa
Pisa-Studie: Bildungskatastrophe kündigt sich an – doch nichts passiert
Seit Jahren weiß man um die schlechten Pisa-Ergebnisse für Deutschland. Von den Schul- und Bildungspolitikern hört man immer das Gleiche. Egal, welcher Partei sie angehören. Zuerst sind sie alle über die Ergebnisse geschockt, nach einigen Tagen gehen sie zum Alltag über und versprechen eventuell Besserung. Über die Gründe für die schlechten Ergebnisse wissen alle Bescheid, doch kaum etwas geschieht.
Wenn doch: Zu wenig und dann noch halbherzig. Volle Klassen in fast allen Schulformen, überlastete Lehrer, gestresste Eltern, ratlose Politiker. Das scheint der Zustand der Bildung in diesem Land zu sein. Eine bildungspolitische Katastrophe kündigt sich an. Das könnte sich auch in unerwünschten Wahlergebnissen widerspiegeln. Es wäre so einfach, wenn wir für uns und diesen Staat einfach Prioritäten setzen würden.Manfred Höffken Köln
Pisa-Studie: Begeisterung für Bildung vermitteln
Die Pisa-Studie 2022 ergab, dass die Gruppe der 15-Jährigen in Deutschland im Vergleich zuvor getesteter Generationen schlechtere Ergebnisse erreichte. Auch im Vergleich zu 15-Jährigen in vielen anderen getesteten Ländern sind die Ergebnisse schlechter. Der Unterschied zwischen den Ergebnissen an den Gymnasien und denen an anderen Schulformen ist so groß wie in keinem anderen Land der Welt.
Das bedeutet nicht: Gymnasien sind gut, alles andere nicht. Es bedeutet: Das deutsche Schulsystem bildet weit über die Hälfte die Jugendlichen unzureichend. Das deutsche Bildungssystem ist Durchschnitt im weltweiten Vergleich – und dadurch auch die Ergebnisse seiner Jugendlichen. Alle Erwachsenen in den Familien, im Bildungssystem und in der Politik sind deshalb weiterhin gefordert, vieles zu verändern, damit die Jugendlichen bessere Chancen erhalten und daraus Nutzen ziehen.
Das deutsche Schulsystem bildet weit über die Hälfte die Jugendlichen unzureichend
Das muss nicht wegen des Rankings, sondern wegen der Haltung geschehen, mit der die junge Generation durch das Leben gehen soll. Wegen der Botschaft, die wir Erwachsene ihnen vermitteln. Wir können Begeisterung für die Themen Bildung, Gesundheit und Demokratie wecken, denn es gibt so viele gute Beispiele auch in unseren Schulen. Weniger Gleichschritt, weniger fixer Lehrplan, dafür mehr Neugier und mehr bewertungsfreie Zeit. Gehen wir es an? Georg Husemann Köln
Pisa-Studie: Schulsystem von diversen Hemmnissen befreien
Alle Jahre wieder kommen das Christkind und der Weihnachtsmann. Aber auch die Krokodilstränen über die Ergebnisse der Pisa-Studien. Alle sind erstaunt und fordern dann neue Maßnahmen. Es ist sicherlich notwendig, immer wieder viele neue Lehrer und Lehrerinnen zu fordern und eine bessere schulische Ausstattung, die Digitalisierung zu verbessern, die Inklusion und den Ganztag auszuweiten, mit Personal und finanziellen Mitteln. Aber diese Forderungen sind mehr als 20 Jahre alt. Und was ist passiert?
Was behindert die schulische Entwicklung? Ich will nur auf wenige Aspekte hinweisen: Die Schulen sind überlastet. Vieles, was gesellschaftlich schiefgeht, sollen die Schulen richten: Toleranz fördern, Kultur und Umweltschutz vermitteln, Kriminalitätsprophylaxe, Integration von Migranten und Migrantinnen, Gesundheitserziehung gestalten und vieles mehr.
Der Föderalismus: Alle vier Jahre will eine gegebenenfalls neue Landesregierung ihre Idee von Schule durchsetzen. Eine nachhaltige schulische Arbeit benötigt aber fünf bis zehn Jahre oder mehr. Es gibt zu viele Vorschriften, die sich zudem manchmal widersprechen, und zu wenig Übertragung von echter Verantwortung auf die Schulen und pädagogischen Einrichtungen.
Es gibt zu viele Bekenntnisse, aber zu wenig Überzeugung im Sinne von „Commitment“, dass eine gute Bildung nicht nur notwendig ist, sondern auch der Umsetzung bedarf. Das betrifft den Respekt vor der Arbeit der Erzieher und Erzieherinnen und Lehrer und Lehrerinnen, die Arbeit der kommunalen Verwaltung, das fehlende langfristige Denken von Länderregierungen und die geringen Kompetenzen für den Bund. Es fehlt das gemeinsame „wir wollen das“!
Es gibt ein zu großes Kompetenzgerangel zwischen Kommunen, Land und Bund. Zu wenige übernehmen tatkräftig Verantwortung. Man verweist gern auf die Kompetenz der Anderen. Die Wertigkeit von Berufen sollte überdacht werden. Nicht jeder und jede muss studieren. Die gesellschaftliche Anerkennung „nicht-universitärer“ Berufe muss verändert werden. Das ist aber ein längerer Prozess.
Schließlich sollte der „Veränderungsmüdigkeit“ im schulischen und pädagogischen Bereich dringend Rechnung getragen werden. Die Überfrachtung mit Vorschriften und Verwaltungsaufwand sollte enden. Zusammengefasst: „Give school a chance“!Peter Szidat Bergisch Gladbach
„Wie jede Menge Einser-Abiture zustande kommen, ist mir ein Rätsel“
Seit 2020 habe ich eine lose Brieffreundschaft mit einem inzwischen 13- jährigen Mädchen, das mir kürzlich einen lebendigen Brief von einer Klassenfahrt nach Borkum geschrieben hat – mit Schreibfehlern ohne Ende und fast ohne Interpunktion. Und das in der 8. Klasse im Gymnasium!
Ich selber habe nach Aussage meines fünf Jahre älteren Bruders, der eigentlich immer hinter seinen Büchern verschwand, schon mit fünf Jahren meiner Mutter aus der Zeitung vorgelesen. Ich schätze, dass ich das nebenbei gelernt habe, als die Erwachsenen sich bemüht haben, meinen zwei Jahre älteren Bruder zum Lesen und Schreiben lernen zu animieren.
Das vierte Schuljahr einer Dorfschule mit einer sehr engagierten Lehrerin habe ich dann mit sehr gut in Lesen, Schreiben und Rechnen abgeschlossen. Wir mussten damals eine Aufnahmeprüfung für das Gymnasium bestehen. Wenn ich über die Ergebnisse der Pisa-Studie lese, würde ja nur ein Bruchteil der heutigen Schüler aufs Gymnasium kommen. Wie da immer wieder jede Menge Einser-Abiture zustande kommen, die damals die absolute Ausnahme waren, ist mir ein Rätsel.Ute Soppe Köln
Pisa-Studie: Lernerfolge stärker einfordern
Die Verbesserung der sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen ist ein wichtiger Ansatzpunkt, um den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler zu steigern. Die konkreten Hebel sind hinlänglich bekannt. Zumeist scheitert es an den nötigen Ressourcen, wie kleinere Klassen, fehlende Lehrkräfte an Grundschulen, fehlendes Personal für eine gute Ganztagsbetreuung, fehlende Zeit und Kraft für eine Einbindung der Elternschaft.
Trotzdem hängt der Erfolg des Lernens in erster Linie von der Zielstrebigkeit, dem Lerneifer und der Lerndisziplin der Schülerinnen und Schüler selbst ab. Darauf bezogen muss ihr Verhalten immer wieder eingefordert und reflektiert werden – von ihnen selbst und den sie unterstützenden Eltern und Lehrkräften. Das ist für alle Beteiligten vor allem in einer an Ablenkungen reichen und/oder bildungsfernen Umgebung sehr anstrengend. Viele sind leider damit überfordert. Paul Klingen Pulheim

In Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften schnitten Schüler und Schülerinnen 2022 in der Pisa-Studie schlechter ab als in der Vor-Coronazeit.
Copyright: dpa
Pisa-Studie: Bürokratie-Abbau und Zentralisierung des Bildungssystems
Ein ganz wesentliches Problem ist der Bürokratismus in dieser Bildungslandschaft, der laut Regierungen angeblich schon seit Jahren reduziert werden soll. Wo ist darin die viel zitierte Verschlankung für den Vorteil von Synergieeffekten – gerade für eine positive Entwicklung der nachfolgenden Generation? Wenn unter anderem immer noch die Schulaufsicht bei den Kommunen, darüber hinaus in NRW auch bei fünf Bezirksregierungen liegt und letztlich noch 16 Bundesländer und der Bund selbst die Richtlinien bestimmen, die dann auch noch an unterschiedlichen parteipolitischen Schwerpunkten orientiert sind, dann mag an dieser Stelle der erste Ansatz für eine Reform notwendig sein.
Wenngleich das föderalistische System in unserem Staat eines der wesentlichen Grundsätze unserer Demokratie ist, so würde es diese reformiert nicht vernachlässigen, wenn zu Gunsten der Bildungslandschaft eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise beschritten wird. In dieser Diskussion müsste ebenso die Frage gestellt werden, ob nicht auch ein Reduzieren der Anzahl der Bundesländer den Abbau der Bürokratie zugunsten der staatlichen Daseinsfürsorge und -vorsorge positive Chancen bietet – gerade auch im Bildungssystem.
Leider gehen unsere Parteien und Parlamentarier da nicht dran, würden sie sich doch damit selbst in ihren unzähligen Ämtern und Funktionen reduzieren. Also beklagen alle weiter die zunehmenden Probleme in unserem Lande und haben zugleich keine Lösung. Schade für die Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler. Wolfgang Wieneritsch Köln
Pisa-Studie: Mehr Schüler für Handwerksberufe begeistern
Wann hört endlich dieses dusselige Wunschkonzert der so herzergreifend sozial eingestellten Mitbürger und Politiker auf? Die Menschen sind nun mal nicht gleich. Sie können auch nicht alle über den gleichen Kamm geschert werden und durch keine noch so gut gemeinten Förderprogramme gleichgestellt werden. Eine bunte Vielfalt der Gesellschaft zeigt sich gerade in den unterschiedlichen Talenten der Menschen, was aber offensichtlich von vielen nicht gesehen werden will. Würden wir die Talente fördern und mehr Schüler für Handwerksberufe begeistern, statt sie zum Abitur auf Händen tragen zu wollen, hätten wir sicher weniger Fachkräftemangel.
Durch noch mehr Geld und Förderung macht der Staat aus einem Lernunwilligen auch keinen Top-Manager
Im Übrigen ist natürlich die Herkunft mitverantwortlich für das Abschneiden der Schüler, denn wenn die Kinder nicht von ihren Eltern zum Lernen erzogen wurden, wird die Schule es auch nicht mehr schaffen. Immer mehr Geld vom Staat zu verlangen, ist eine abstoßende Mode in unserer Hängematten-Gesellschaft geworden. Deutschland wurde aus Leistungsbereitschaft, Disziplin und Fleiß zu einer führenden Wirtschaftsnation geformt. Die heutige Gesellschaft scheint nun eine entgegengesetzte Richtung durch Leistungsverweigerung, Egoismus und Trägheit einzuschlagen. Durch noch mehr Geld und Förderung macht der Staat aus einem Lernunwilligen auch keinen Top-Manager. Gottfried Josef Remagen Nettersheim
Pisa-Studie: Schüler früh ans Leistungsprinzip heranführen
Bedauerlicherweise reagiert die Politik auf alle Mängel stets mit Vorschlägen, die weitere finanzielle Mittel erfordern. Mehr Lehrer, mehr Betreuung, etc. Es geht auch billiger. Der Gedanke entspringt meinem eigenen Werdegang und hat guten Erfolg gezeigt. Als Kind habe ich im elterlichen Landwirtschaftsbetrieb unterstützt, mit 18 war ich Kfz-Mechaniker, mit 23 Diplom-Ingenieur. Ich schlage also vor, den jungen Menschen frühzeitig das Leistungsprinzip nahezubringen und sie daran heranzuführen.
Ab einem Alter von zehn Jahren könnten junge Leute Schulgebäude, Schulhöfe, Turnhallen reinigen. Das hat gleich mehrere Vorteile: Die Wertschätzung steigt, die Kosten sinken und mutwilliges Verunreinigen sowie Vandalismus unterbleibt eher. Zur Wertschätzung: Wer derartiges eine Zeitlang gemacht hat, wird eine stärkere Motivation verspüren, einen höheren Bildungsabschluss zu erlangen. Positiver Nebeneffekt: Die jungen Menschen verbringen weniger Zeit in bildungsfernen Familien und es bleibt weniger Zeit für Unsinn. Nachteile: keine. Reinhold Bisenius Bergisch Gladbach
Pisa-Studien-Ergebnis: Resultat schulpolitischer Reformen
Lange dachte ich, die zuständigen Bildungsministerinnen wüssten schon, was das beste Schulsystem für die Zukunft unseres Landes sei: Das stimmt nicht! Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Bildung von 2010 bis 2017, zerstörte ein bis dahin gut funktionierendes Bildungssystem, welches gegliedert war in Grund-, Haupt-, Realschule, Gymnasium und Aufbauschulen. Zudem gab es exzellente Hilfen für Schüler in Förderschulen. Mit ihrem Slogan „Kein Kind soll zurückbleiben!“ ließ sie genau die Kinder zurück, die lernwillig waren.
Mit dem Anspruch, auch jedes noch so lernunwillige Kind zum Abitur zu bringen, brachte sie selbst hoch motivierte Lehrpersonen an den Rand des Burnout! Warum fehlen 80.000 Lehrkräfte? Warum verließen im letzten Jahr 1000 Lehrpersonen in Berlin den Schuldienst? Nicht, weil sie mehr Gehalt fordern. Nicht, weil sie mehr Digitalisierung wollen. Nicht, weil die Schulen marode sind. Sondern, weil ihnen Respekt fehlt! Es fehlt Anerkennung, Ruhe, Disziplin und eine gemeinsame Vision für alle hier im Land, wofür es sich lohnt zu leben, zu lernen, zu arbeiten und etwas zum Wohle der Gemeinschaft zu leisten. Rita Weber-Verlinden Köln
