Luise ist sie die erste Patientin, die an der Uniklinik Köln mit dem neuen Medikament Lecanemab behandelt wird. Eine Geschichte der Hoffnung.
Lecanemab gegen DemenzNeues Medikament schenkt Kölns erster Alzheimer-Patientin Hoffnung

Wenn Luise mit ihrer Partnerin Memory spielt, gewinnt sie. Trotz Krankheit verfügt sie über ein sehr gutes visuelles Gedächtnis. (Symbolbild)
Copyright: Sven Hoppe/dpa
Luises Gehirn arbeitet hart. Die Stimmung zwischen den Nervenzellen kann man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen wie bei einem stressigen Umzug, als müsste man dringend einen komplexen Schrank aufbauen und würde dabei immer wieder feststellen, dass wesentliche Schrauben irgendwo im Chaos verschüttet sind. Eher angespannt. Luises Gehirn nimmt Umwege, zimmert Behelfskonstruktionen, lässt sich kreative Lösungen einfallen. Am Ende steht da ein solider Schrank und der Beobachter kann erstmal gar nicht erkennen, welcher Aufwand sich da hinter den Kulissen abspielte. Aber Luise merkt das alles sehr wohl. Sie ist erschöpft.
„Wenn ich mehrere Dinge gleichzeitig beachten muss, spüre ich das richtig im Kopf. Wenn mein Gesprächspartner plötzlich das Thema wechselt. Oder wenn ich längere Zeit Auto fahre. Ich bin außerdem sehr lärmempfindlich. Das strengt mich richtig an.“ Luise ist 74 Jahre alt, sie malt an ihrem großen Schreibtisch in der Küche, am liebsten die Natur und Gesichter, gern in Acryl, sie ist Mutter, Großmutter und Partnerin. Und Luise ist offiziell die erste Patientin Kölns, deren Alzheimer-Erkrankung mit dem Medikament Lecanemab behandelt wird. Seit Anfang September ist der monoklonare Antikörper in Deutschland verfügbar.

Irgendwann verlor Luise den zeitlichen Überblick über die Wochentage. Auch bei den Bankgeschäften schlichen sich Fehler ein. Manchmal verlegt sie Dinge.
Copyright: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn
Auf den Superlativ ist Luise ein bisschen stolz, „aber auch darauf, dass ich ja auch bei der Weiterentwicklung dieser Behandlung helfen kann“. Denn ihre Therapie wird mit aufwändigen Tests begleitet. Der 9. September war für sie kein verregneter Herbsttag. Er war ein „Neustart“, wie sie sagt. Eine Stunde lang floss an diesem Dienstag eine Flüssigkeit in ihren rechten Arm, die in ihrem Gehirn aufräumen soll. Beta-Amyloide haben sich da nämlich zu Ablagerungen zusammengerottet. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie am Straßenrand einer Millionenstadt. Alle Anwohner stellen ihren Müll raus, aber niemand holt ihn ab. Plaque entsteht, und weil alles so unordentlich ist, haben auch die Nervenzellen keine Lust mehr auf ein Leben in derart unattraktiver Umgebung. Sie sterben ab. So ähnlich erklärt das Professor Özgür Onur von der Uniklinik Köln, wenn er Laien verständlich machen will, was im Gehirn von Alzheimer-Patienten passiert. Lecanemab soll die Müllberge fortschaffen.
Lecanemab heilt nicht. Es tritt nur auf die Bremse
Die gute Nachricht: Alle Studien zeigen, dass das gut, manchmal sogar vollständig gelingen kann. Die weniger gute Nachricht: Einmal abgestorbene Nervenzellen kommen nicht wieder zurück. Auch dann nicht, wenn die Umgebung nett hergerichtet ist. Und auch für einen kompletten Krankheitsstopp reichen die Möglichkeiten des Medikaments nicht aus. Lecanemab tritt nur auf die Bremse. „Wir verlangsamen das Fortschreiten um ein Drittel“, sagt Onur.
Luise wird mit dem Zustand, den sie ohne Medikament in einem Jahr erreichen würde, also erst in 18 Monaten konfrontiert werden. „Es ist eine Hoffnung, es sind geschenkte Tage, aber ich darf das auch nicht zu hoch hängen“, sagt Luise. Sie sitzt in Onurs Büro an der Uniklinik. Grüne Jacke, ein Tuch in sonnigen Farben um den Hals, Haare und Augen haben die Farbe von warmem Karamellpudding, wenn sie ihren Kopf zur Seite wendet, um ihre Partnerin Brigitte anzusehen, schneidet ihre Nase ein scharfes, klassisches Profil in den Raum.
Luise heißt gar nicht Luise, ihren richtigen Namen soll niemand in der Zeitung lesen. Schließlich ist die Alzheimer-Erkrankung immer noch ein Tabu. Ihr engstes Umfeld wisse natürlich Bescheid. Hier habe sie schon seit der Diagnose vor drei Jahren offen über das Thema kommuniziert. Sie fühlt sich dort generell auch gut aufgehoben, wenn sie auch selbst unter engen Bekannten eine Veränderung im Umgang registriert. „Ich merke, dass ich zu manchen Lesungen nicht mehr eingeladen werde, obwohl ich eigentlich gute Texte schreibe. Dass man nicht mehr über alles mit mir spricht. Es ist eher eine liebevolle Sorge, die ich spüre. Wahrscheinlich will man mich nicht überlasten. Aber ich habe auch Angst, dass ich irgendwann anderen zur Last falle.“
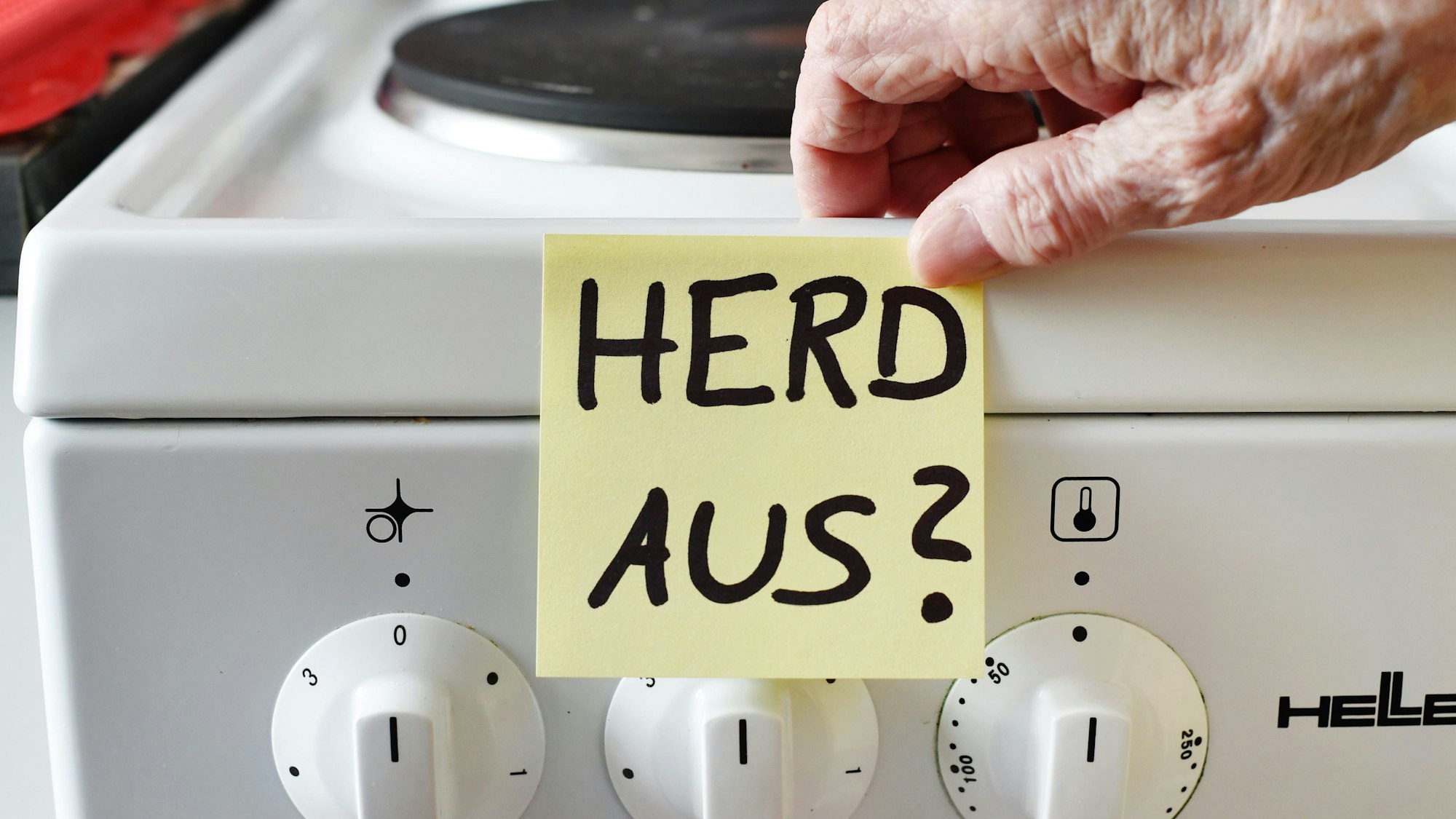
Offiziell dement sind Patienten erst, wenn sie ihren Alltag nicht mehr sicher bewältigen können.
Copyright: dpa
Manchmal zieht sie sich zurück. Kürzlich hat sie eine Einladung zu einer Unternehmung im Freundeskreis erhalten. „Jetzt macht sie sich Sorgen, dass es den anderen zu viel werden könnte mit ihr“, erzählt Brigitte. Der Kreis der Besorgten, er soll sich möglichst nicht noch erweitern. Schließlich will Luise sich in Optimismus üben. Im Radfahren, Tischtennisspielen, im Jonglieren, im Tagepflücken.
Die Winterdepression ist verschwunden seit Luise die Krankheit akzeptiert hat
Wie verändert sich das Leben, wenn man weiß, dass man dabei ist, es zu vergessen? Die Diagnose habe sie sehr traurig gemacht, natürlich. Und da ist freilich auch eine Beklemmung, die sich breit macht. „Ich habe Angst, dass ich mich irgendwann verloren fühle in der Welt“, sagt Luise. Hätte da Unwissenheit nicht auch eine Gnade sein können? Luise ist froh, dass sie mehr oder weniger zufällig über ihr Schicksal aufgeklärt wurde. Eigentlich wollte sie als Tochter einer dementen Mutter nur zum Forschungsfortschritt beitragen und hatte sich deshalb zu freiwilligen Tests an der Uniklinik angemeldet. Die Ärzte entdeckten Auffälligkeiten, eine Lumbalpunktion bestätigte die Ahnung.
Einer Phase der Niedergeschlagenheit folgte aber ein Perspektivwechsel. In gewisser Weise hat die Diagnose Luises Gemüt sogar erhellt. „Früher litt ich an Winterdepression. Heute hat sich Akzeptanz eingestellt. Ich bin dankbar für jeden Tag und will mein Leben nicht von der Angst überschatten lassen. Außerdem denke ich oft daran, dass ich eben schon 74 Jahre alt bin. Das ist doch auch schon was. Es hätte mich auch früher treffen können.“ Und dann ist da natürlich der Glaube an den Fortschritt, den sie mit Onur teilt: „Wir hoffen, dass die Entwicklungen weitergehen und wir zukünftig noch wirksamere Präparate bekommen.“ Und auch die geschenkten Tage könnten sich vermehren, rechnen sich Wissenschaftler doch aus, dass sich die Bremswirkung des Medikaments bei längerer Gabe erhöht. Entsprechende Langzeitstudien aus dem Ausland müsse man aber noch abwarten.

Professor Özgür Onur von der Uniklinik Köln sagt, dass man auch selbst etwas für die Hirngesundheit tun kann. Dabei helfe eine Kombination oft am besten: „Spazierengehen ist schön und gut. Aber Tischtennisspielen und Jonglieren ist natürlich besser, weil es Bewegung und Gehirnaktivität verbindet.“
Copyright: Thilo Schmülgen
Özgür Onur lobt Luises aktive Lebensgestaltung. Sie ist ein Vorbild. Nicht nur für Erkrankte. Denn geistiges Regesein ebenso wie Bewegung und eine gesunde Ernährung dienten dem Gehirn als Schutzschild. Besonders günstig sei eine Kombination. „Spazierengehen ist schön und gut. Aber Tischtennisspielen und Jonglieren ist natürlich besser, weil es Bewegung und Gehirnaktivität verbindet“, sagt Onur. Ein Schlüssel zum Erfolg sei auch der Spaß. „Niemand muss eine Sprache lernen, wenn er darauf keine Lust hat, ohnehin wäre diese Herausforderung viel zu hoch. Und auch wer beim Memory immer verliert und dadurch frustriert ist, spielt vielleicht lieber Mensch-ärgere-dich-nicht.“ Onur ist überzeugt, dass Luise durch ihre aktive Lebensgestaltung der Krankheit schon vor vielen Jahren einen strammen Zügel angelegt hat. Ganz ohne Medikament.
Ich kann schon mal Fehler machen und das tut mir dann immer sehr leid
Es ist nicht so, dass Luise die einzige Patientin wäre, die auf die Freigabe von Lecanemab gewartet hat. Aber sie ist eine der wenigen, die als Patientin in Frage kommt. Denn die Kriterien beschränken den Kreis relativ eng. Ein paar hundert, schätzt Onur, könnten in Köln ebenfalls für die Therapie geeignet sein, etwa 50 von ihnen sollen in den kommenden Wochen in der Uniklinik mit der Infusion im 14-tägigen Intervall starten.
Erstens ist Luise körperlich gesund und hat so kaum Nebenwirkungen zu befürchten. Zweitens wurde ihre Erkrankung in einem sehr frühen Stadium entdeckt. Nur dann ist die versprochene Wirksamkeit zu erwarten. Luise hat Alzheimer. Sie ist aber im eigentlichen Sinne noch nicht dement. „Von Demenz sprechen wir erst, wenn die Person Probleme hat, den Alltag zu bewältigen“, sagt Onur. So ist das bei Luise nicht. Aber ihr Denken birgt Lücken. „Als erstes merkte ich das an einer zeitlichen Desorientierung. Ich konnte nicht mehr sagen, wann ich nächste Woche Besuch bekomme. War das Dienstag? Oder Mittwoch? Selbst dann nicht, wenn wir das erst gerade vereinbart hatten.“ Sie vergisst, was kurz zuvor besprochen wurde. Termine machen Bekannte nun zur Sicherheit auch noch mit Brigitte aus. Auch die Bankgeschäfte muss sie erledigen. Luise hat dafür extra das Finanzinstitut gewechselt. „Ich kann schon mal Fehler machen und das tut mir dann immer sehr leid“, sagt Luise und wendet betrübt den Kopf.
Verantwortung abgeben, vielleicht auch ein Stück Selbständigkeit und Kontrolle – das ist nichts, was das Beziehungsmodell der beiden Frauen vorsah, als diese sich vor mehr als 20 Jahren kennenlernten. „Luise ist sehr selbständig, sehr spontan. Ich bin gründlicher, sie würde mich vielleicht gar als zwanghaft bezeichnen“, sagt Brigitte. Wenn Luise mal wieder mit löchrigem Erinnerungsvermögen kämpft, müsse Brigitte sich mittlerweile zurückhalten, um ihr Aufgaben nicht einfach abzunehmen. „Einerseits denke ich: Ach komm, ich übernehme das, kontrolliere zumindest besser alles nach. Andererseits will ich sie auch nicht dominieren.“ Luises zarte Haut um die Augen durchziehen feine Lachfältchen, wenn Brigitte so redet. „Das ist schon immer so bei uns. Ich mache einfach. Da geht dann schon mal was schief, aber dann denke ich: Was soll’s?“ Das Karamell in ihren Augen leuchtet plötzlich grünlich. „Dann stecke ich das eben weg und gehe weiter.“

