Wie wir unser Gehirn wappnen und zu mehr Kreativität und Konzentration anspornen können, weiß Neurowissenschaftler Henning Beck.
KI verändert unser Denken„Kein Mensch hat Ideen, wenn er auf einen Bildschirm starrt“

Wie das menschliche Gehirn genau denkt, ist noch nicht komplett erforscht.
Copyright: Thilo Schmülgen
Herr Beck, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel „Besser denken“. Was bedeutet für Sie persönlich denn besser denken? Geht es eher um Effizienz oder eher um Kreativität oder liegt der Schlüssel da wo ganz woanders?
Henning Beck: Wenn es um eines nicht geht, dann um Effizienz. Denn alles, was der Effizienz bedarf, wird in Zukunft garantiert von künstlicher Intelligenz erledigt werden. Vereinfacht gesagt, handelt es sich bei KI um eine ultimative Optimierungsmaschine. Was KI nicht ersetzen kann, ist Effektivität. Es geht bei „besser denken“ also darum, sich zu fragen, wo das Ziel liegt, Dinge kritisch zu hinterfragen, Ursachen und Wirkungen zu unterscheiden, mutige Entscheidungen zu treffen und alles auch einmal vom Ende her zu denken. Kreativ und neuartig an eine Fragestellung heranzugehen und etwas Neues zu erschaffen, ist oft nicht effizient, aber kann sehr effektiv sein.
Sie sagen, dass das Gehirn oft fehlerhaft arbeitet. Ist das nur eine Schwäche, oder kann das auch eine Stärke sein?
Verglichen mit einem Computerchip ist das Gehirn sehr fehleranfällig. Menschen verhaspeln sich beispielsweise alle paar hundert Wörter. Aber in gewisser Weise besteht die eigentliche Kraft des menschlichen Denkens gerade in der Möglichkeit, Fehler zu machen, Dinge auszuprobieren und auch zu scheitern. Da gilt es, eine Balance zu finden. Wer ein Auto bauen will, muss gewisse Regeln beachten. Aber wer etwas Neues erfinden will, eine neue Mobilität erschaffen will, der muss ins Risiko gehen und Fehler machen dürfen. So gesehen ist der Perfektionismus das Ende allen Fortschritts.
Worin begründet sich denn diese Fehleranfälligkeit des Gehirns?
Die Entscheidungen unseres Gehirns fallen nicht zufällig, aber sie sind auch nicht vollständig von Gesetzen bestimmt. Und diese Unschärfe gibt uns die Freiheit, Sachen auszuprobieren oder sich umzuorientieren. Kluge Menschen optimieren sich nicht ständig, sondern treffen Entscheidungen. Und sie wechseln von Zeit zu Zeit auch ihre Strategie. Jeder Spitzensportler wechselt seine Trainingsmethoden. Nur ein Depp wird immer an seinen alten Ideen festhalten, wenn sich die Welt um einen herum ändert.
Alles zum Thema Deutsche Bahn
- Bahnverkehr im Norden bis Sonntag stark eingeschränkt
- Kritische Infrastruktur Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich
- Bahn Fernverkehr rollt doch erst ab Mittag wieder an
- Winterwetter Unwetterwarnung und weiter Störungen im Bahnverkehr in NRW
- So ist die aktuelle Lage Ein letztes Winterwochenende – dann droht Glatteis
- Sturmtief Elli In Köln hat der gefürchtete Schneesturm versagt – „Du hast mich schwer enttäuscht“
- Bahn will Fernverkehr im Norden am Samstag wieder aufnehmen
Wie kann ich kluge Entscheidungen trainieren?
Wechseln Sie Ihr Umfeld, suchen Sie neue Orte auf, reisen Sie, gehen Sie ins Kino oder besuchen Sie Veranstaltungen, die Sie sonst nie besuchen. Auch eine gute Idee: Befragen Sie nicht nur Experten, sondern auch Leute, die sich nicht mit meinem Problem auskennen. Aus deren Nachfragen ergeben sich oft neue Perspektiven. Sprechen Sie überhaupt mit Menschen, denn die sind oft unberechenbar und das bringt uns auf neue Gedanken. Informationen sammeln führt nur bedingt zu guten Entscheidungen. Für die wirklich wichtigen Fragen des Lebens kann man ohnehin nicht ausreichend Informationen sammeln. Überlegen Sie mal, Sie würden erst heiraten, wenn Sie alle Menschen der Welt auf Eignung überprüft hätten. Dazu kommt, dass der Mensch vor allem durch die Fähigkeit besticht, mit relativ wenigen Informationen intuitiv entscheiden zu können. Oft sind wir mit diesen Bauchentscheidungen am Ende übrigens am zufriedensten.
Braucht unser Gehirn auch mal Leerlauf?
Unbedingt. Kein Mensch hat Ideen, wenn er auf einen Bildschirm starrt. In der Regel entsteht Kreativität in Bewegung, beim Bügeln, beim Radfahren, Duschen oder zumindest dann, wenn man den Blick schweifen lassen kann. Denn dann kann man Informationen, die man vorher gesammelt hat, verdauen.
Muss man das in der Arbeitswelt mehr berücksichtigen? Da sitzt man ja die meiste Zeit vor dem Bildschirm.
Natürlich können Sie nicht dauernd duschen während der Arbeitszeit. Aber Sie können auch nicht dauernd Informationen konsumieren. Wenn Sie dem Denken nicht genügend Zeit geben, können Sie sich nicht mehr konzentrieren, Sie werden vergesslich, es fällt schwer zu priorisieren. Das ist, als würden Sie dauernd essen. Irgendwann platzen Sie. Sie müssen auch mal verdauen. Unser Denken wird nicht besser durchs Denken, sondern durch die Pause, die wir machen. Wechseln Sie den Raum, lassen Sie den Blick schweifen, unterhalten Sie sich.
Eine beliebte kreative Denkmethode in der Gruppe ist das Brainstorming, ist das hilfreich?
Nee, das ist Schwachsinn. Sie können sich in der Gruppe in Gesprächen mit Ideen aufladen. Auf eine gute Idee kommen Sie da aber selten. Gerade was Kreativität betrifft, ist die Gruppe weniger leistungsfähig als die Summe der einzelnen Personen. Man hat nachgewiesen, dass der IQ einzelner Personen in der Gruppe um zehn bis 15 Punkte sinkt. Das liegt daran, dass viel von der Dynamik überlagert wird: Einer will der Chef sein, einer denkt, er kann sich durchmogeln, der nächste will sich nur einschleimen. Außerdem werden die Gehirnareale, die für das freie Kombinieren zuständig sind, ja eben dann aktiviert, wenn wir nicht gezwungen an etwas rumdenken. Und dann auch noch gemeinsam? Das können Sie vergessen.
Wenn wir allein sind und Pause machen, gucken wir meist auf unser Handy. Was macht das mit unserem Gehirn?
Nichts Gutes jedenfalls. Menschen, die besonders viel Multitasking betreiben, verlieren im Laufe der Zeit die Fähigkeit zu priorisieren und Informationen zu gewichten. Wir scrollen auf Social Media, wenn wir gelangweilt sind und Input suchen. Die Hoffnung erfüllt sich aber nicht, weil niemand zufrieden ist oder Bestätigung findet, wenn er irgendwelche Videoclips angeguckt hat. Am Ende sind wir alle noch gelangweilter. Eine Studie hat ergeben, dass das Internet auf Smartphones ursächlich dafür ist, dass man schlechter denkt. Probanden, denen man das Internet auf dem Smartphone ausgeschaltet hat, konnten sich nach wenigen Wochen besser konzentrieren und erreichten kognitiv bessere Ergebnisse. Auch die Stimmung verbesserte sich, und zwar in ähnlichem Maße wie nach der Gabe von Antidepressiva.
Wie schütze ich mein Gehirn?
Erobern Sie auf jeden Fall die Kontrolle zurück. Das machen auch diejenigen, die Milliarden mit Smartphones verdient haben. Wenn ich da in Kalifornien bei Tech-Mogulen zu Besuch bin und legte mein Handy auf den Tisch, dann würden die mich als disziplinlos bemitleiden. Fast wie einen Abhängigen. Weil sie wissen, wie gefährlich das Ding sein kann. Wer stark ist, nutzt das Smartphone nur zu gewissen Zwecken. Und nur zu gewissen Zeiten. Meine Faustregel: Morgens nicht vor und abends nicht nach dem Zähneputzen. Es sollte zudem zu Hause Räume geben, die handyfrei sind. Das Schlafzimmer zum Beispiel. Wer konzentriert arbeiten will, sollte das Gerät ausschalten und außerhalb der Sichtweite legen. Wer sein Handy sieht, wird abgelenkt. Und dazu muss es keineswegs klingeln. Studien zeigen, dass neun von zehn Handynutzungen vom Nutzer ausgehen. Wer außerdem Hobbys hat, bei denen er die Geräte grundsätzlich nicht nutzt, ist viel mehr in der Balance, kann geistig besser verdauen und am Ende nicht nur klüger, sondern auch zufriedener.
Wann ist Internetnutzung weniger bedenklich?
Immer dann, wenn ich ein Ziel habe. Also: Wer auf Wikipedia gucken will, wann Albert Einstein geboren ist, der wird davon nicht süchtig. Oder wer wissen will, wann die Bahn fährt. Dafür ist das mobile Netz sehr nützlich. Bedenklich wird es nur dann, wenn wir ohne Ziel durch das Angebot scrollen. Dann haben wir die Kontrolle verloren.
Wenn Sie Menschen eine Sache übers Denken mit auf den Weg geben könnten, was wäre das?
Wer besser denken will, muss uneitel sein. Und keinesfalls starrköpfig. Künstler, Erfinder oder erfolgreiche Unternehmer haben sich schon immer dadurch ausgezeichnet, dass sich ganz bescheiden immer wieder hinterfragt haben. Das ist übrigens eine Fähigkeit, über die nur der Mensch verfügt: Sich absichtsvoll immer wieder zu hinterfragen. Und dazu sollten wir nie zu faul werden. Denn das ist ja vielleicht die größte Gefahr: Nicht, dass wir dümmer werden. Sondern dass wir aus Faulheit nicht selbst nachdenken, sondern für ein paar Euro ChatGPT für uns denken lassen. Und so das Heft des Handelns an eine strunzdumme KI übertragen.
Henning Beck ist promovierter Neurowissenschaftler und hat zahlreiche Bücher über das Denken geschrieben. Eines davon heißt „Besser denken“ und ist bei Econ erschienen.
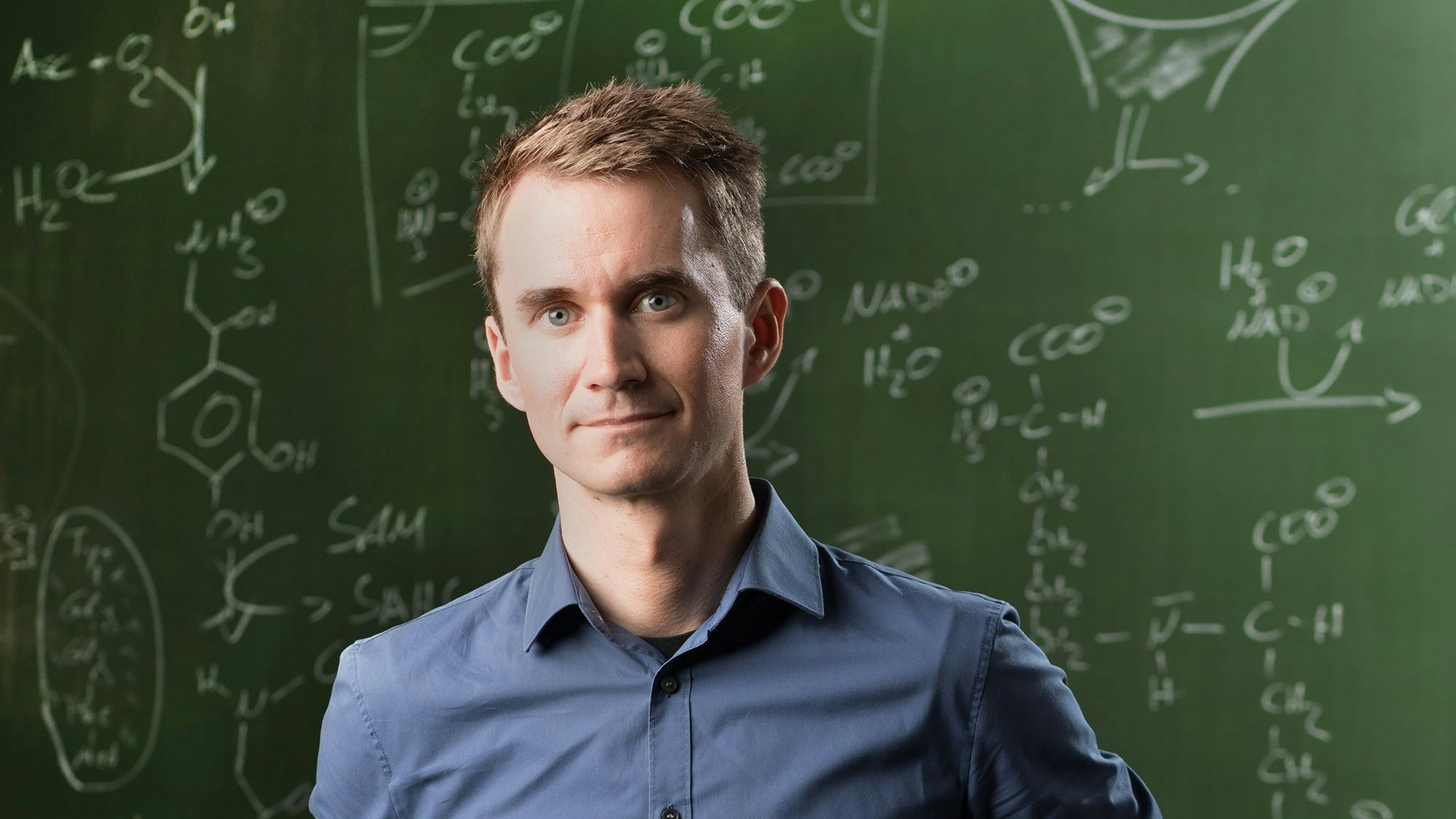
Henning Beck ist Biochemiker, Neurowissenschaftler, Autor und Poetry-Slammer.
Copyright: Hans Scherhaufer/Ullstein Buchverlage/dpa-tmn
