Psychologische Hilfe ist in England nach nur drei Wochen verfügbar. Deutsche Fachleute wollen ein ähnliches System etablieren.
Vorbild GroßbritannienSo wollen Fachleute psychologische Hilfe für alle möglich machen
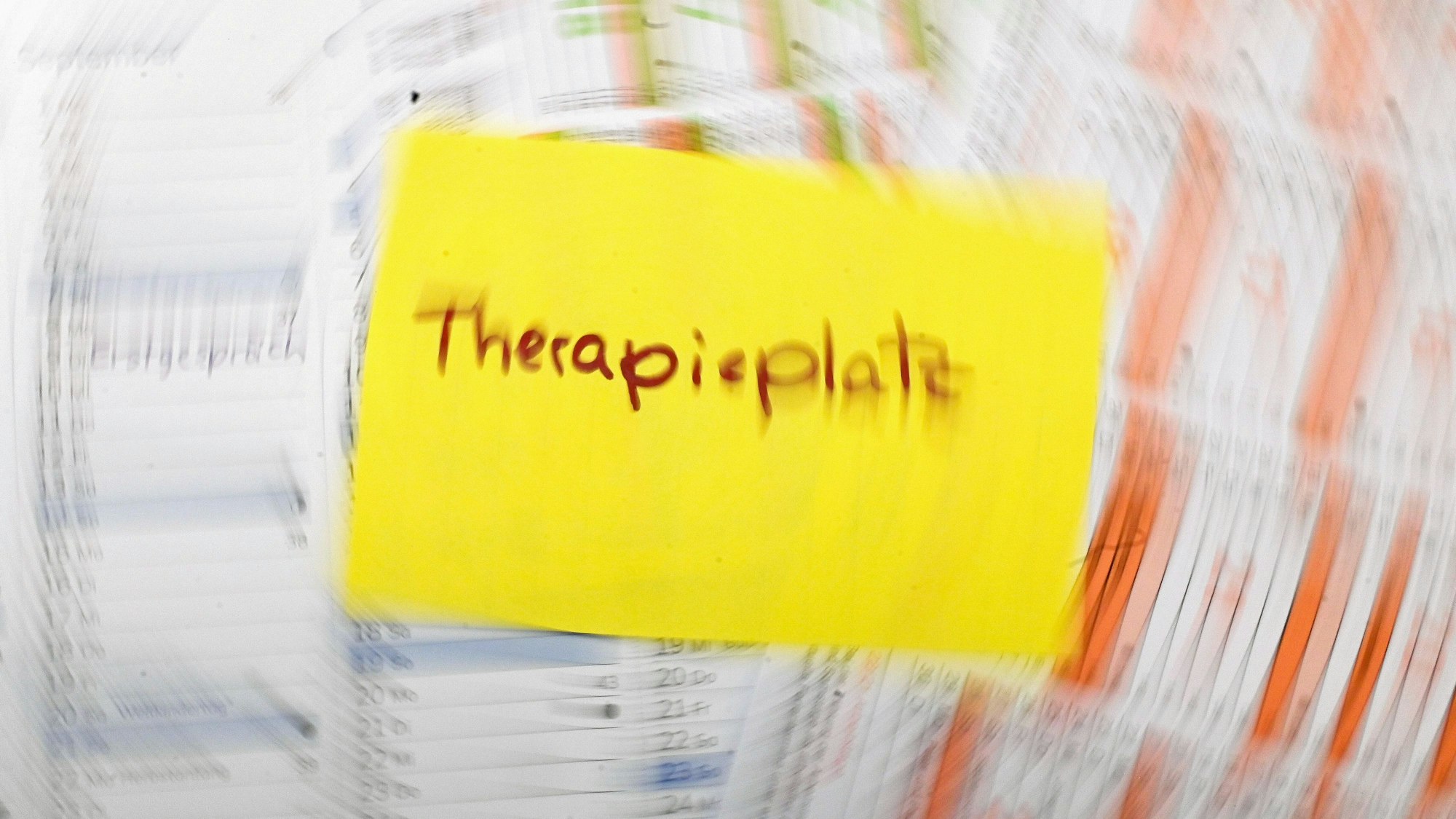
Das englische Modell zur schnellen psychologischen Unterstützung zeigt in mehreren europäischen Ländern Erfolge. (Symbolbild)
Copyright: Katharina Kausche/dpa/dpa-tmn
Bei Angstzuständen oder anhaltender Niedergeschlagenheit einfach ein Servicecenter kontaktieren – und bereits drei Wochen später mit einer geeigneten Therapie starten? In England ist das mittlerweile Realität. Hilfesuchende warten dort im Schnitt nur 18 Tage auf professionelle Unterstützung, erklärte der Psychologe David Clark beim Jahrestreffen des Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit in Bochum, das noch bis Sonntag andauert.
Auch in Deutschland sei eine solche koordinierende Stelle notwendig, um bestehende Hilfsangebote gezielt an Betroffene weiterzuleiten, erklärte Zentrumssprecher Peter Falkai. Der vor fünf Jahren gegründete Forschungsverbund, der nun für weitere zwei Jahre gefördert wird, könne diese Aufgabe übernehmen. Bislang sei vielen Menschen jedoch nicht einmal bekannt, dass es eine eigene Notfallnummer für psychische Krisen gibt.
Erfolge in ganz Europa
Das englische Modell hat sich laut Clark auch in Norwegen, Spanien oder Litauen bewährt. Zwar seien kleinere Anpassung in den Ländern nötig; im Grundsatz funktioniere es aber überall ähnlich. Entscheidend sei, dass sämtliche Vorgänge erfasst und die entsprechenden Daten ausgewertet würden. So habe sich die Behandlung Erkrankter deutlich verbessert: Hätten sich vor etwa zehn Jahren 40 Prozent von ihnen vollständig erholt, so sei es inzwischen bereits die Hälfte.
Davon profitierten nicht nur die betroffenen Personen selbst, sondern auch die Wirtschaft: Genesene in England hätten nach ihrer Rückkehr ins Berufsleben ihr Einkommen steigern können, wie die Daten belegen. Insgesamt liegen mittlerweile anonymisierte Gesundheitsdaten von acht Millionen britischen Patientinnen und Patienten vor – laut dem Experten vermutlich die größte Sammlung dieser Art weltweit.
Neue Konzepte brauchen Mut
Konkret will der Forschungsverband jene Unikliniken und universitäre Psychotherapie-Ambulanzen vernetzen, die bereits mit Datenerfassung arbeiten. Es sei ein wichtiges Anliegen, dass die Bevölkerung von der Forschung profitiert, sagte Sprecherin Silvia Schneider.
In den vergangenen zwei Jahren seien die sechs Standorte enger zusammengewachsen, nun gehe es darum, ihre Finanzierung dauerhaft abzusichern. Zudem rief Schneider die Politik dazu auf, bei der Entwicklung neuer Versorgungskonzepte mehr Mut zu zeigen. (kna)


