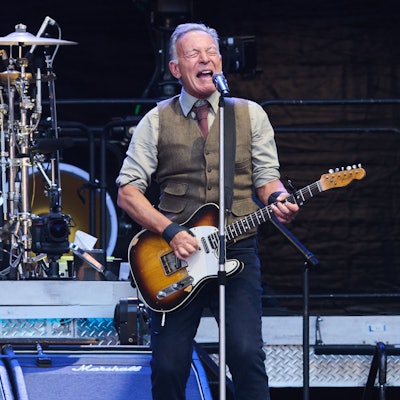Im Biopic „Springsteen: Deliver Me from Nowhere“ sieht Jeremy Allen White zwar nicht aus wie der Boss – aber er rockt den Film.
„Deliver Me from Nowhere“Ein Film für Springsteen, Springsteen-Fans, Amerika und die Freiheit der Kunst

Regisseur Scott Cooper (l) und Schauspieler Jeremy Allen White (r) stehen im Berliner Zoo Palast auf dem Roten Teppich bei der Deutschlandpremiere von ´„Deliver Me From Nowhere“.
Copyright: Andreas Gora/dpa
Furchtbar passend sei dieser Wagen für einen Rockstar-Teufelskerl, sagt der Autoverkäufer zu Bruce Springsteen, der noch zögert, den schwarzen Chevy Camaro mit dem 305er-V8-Motor zu kaufen. „Ich weiß, wer sie sind“, fügt der Mann hinzu. „Dann weiß das schon mal einer von uns“, sagt der Musiker. Und das ist die Story.
Die Story eines Mannes, der gerade einen Hit hatte („Hungry Heart“) aus einem Rock’n’Roll-Album („The River“), das die Musikkritik 1980 unisono begeisterte. Jetzt, nach einer 18-monatigen triumphalen Tour mit seiner E Street Band, könnte alles im Trott so weitergehen. Die Plattenfirma fordert Nachschub an Chartsstoff, wie es Plattenfirmen seit je taten und viele Künstler und Bands damit in die Rat-, Identitäts- und Erfolglosigkeit führten.
Bruce Springsteen will nicht das Immerselbe wiederholen
Aber der Gedanke an Wiederholung desselben frisst ein „Nein“ ins Herz des Musikers. Trott kommt von Trottel, und im Trott wird er in den 43 Jahren nach „Nebraska“ nie mehr sein. 1982 stellt er sich die Frage: Wer bin ich, wer will ich sein? Und macht sich auf die Suche nach sich. „Rette mich vor dem Nichts“, heißt der Filmtitel auf Deutsch – eine Songzeile aus dem „Nebraska“-Song „Open All Night“.
Scott Cooper hat Erfahrung mit Musikfilmen, sein Debüt war „Crazy Heart“ (2009), in dem Jeff Bridges einen Countrymusiker in der Abwärtsspirale des Erfolgs spielte. Und nachdem Timothée Chalamet in „Like A Complete Unknown“ (2024) ein hinreißend schwieriger Bob Dylan war, ist Jeremy Allen White ziemlich perfekt als depressiver Zweifler Springsteen.
White sieht nicht wie Springsteen aus, aber das ist schnurz
Nein, Jeremy Allen White sieht dem jungen Bruce Springsteen nicht allzu ähnlich. Aber wohin eine Lookalike-Besetzung führt, erlebt man seit Jahrzehnten bei vielen Beatles-Tributebands. Dann ähnelt der Schlagzeuger Paul McCartney ein wenig, dafür hat der Bassist Augen und Nase wie Ringo Starr, aber wenn sie „A Hard Day’s Night“ spielen, wird es „A Day’s Hard Night“ für die Zuhörer.
White sieht aus wie der Küchenchef aus der Serie „The Bear“, aber er rockt den Film. Er findet den Geist und die Seele von Springsteen und liefert das glaubwürdige Porträt eines sensiblen Künstlers, der die Musik zu sehr liebt, um dem Superstar der Zukunft in sich schon über den Weg zu trauen.
Springsteen ist als Kind trotz Vater vaterlos
Und in dem die Vergangenheit tanzt, der schwere Konflikt mit seinem Vater Douglas – großartig wie immer: Stephen Graham, der in schwarz-weißen Rückblenden psychische Gärung zeigt. Der Vater, alkoholkrank und aggressiv, findet keinen Weg zu seinem Sohn Bruce (Matthew Anthony Pellicano Jr.), der Sohn, irritiert, verletzt, weiß nicht, was von ihm erwartet wird, leidet unter der Sprachlosigkeit und wird trotz Vater vaterlos.
Der Film ist zugleich eine Empfehlung für Springsteens erzählerisch wohl eindringlichstes Liederbuch „Nebraska“. Er zeigt, wie diese schwarz-weißen Thriller und Dramen entstanden, wie Springsteen die grobkörnigen Albträume, die von amerikanischen Verlierern, vom Niedergang und von der Endlichkeit erzählen, fiebrig zu Papier bringt. Das ist der Mann, dem in „My Father’s House“ Fremde die Tür zum Haus seiner Kindheit öffnen, da ist der Verbrecher, der im fiebernden „State Trooper“ fleht, der Polizeiwagen möge ihn nicht anhalten, weil er den Polizisten sonst töten muss.
Da ist der „Highway Patrolman“, der seinen kriminellen Bruder über die kanadische Grenze entkommen lässt, weil „der, der seiner Familie den Rücken zukehrt, nichts taugt“. Und „Ich denke einfach, es liegt eine Gemeinheit in der Welt“, singt der Serienmörder, der im Titelsong auf dem elektrischen Stuhl auf den Stromstoß wartet.
White singt Springsteens Lieder auch selbst, sein Heisersein wirkt zuweilen etwas gepresst. Aber wie der Musiker darum kämpft, die spartanische Lo-Fi-Musik seiner „Nebraska“-Demos mithilfe seines Managers Jon Landau (sehr gut: Jeremy Strong) bei der Plattenfirma durchzuboxen und zugleich im Wissen um den Gegenwind und das Risiko immer mehr seine innere Balance verliert, muss man gesehen haben. Auch wie die Liebe – Odessa Young spielt die Kellnerin Faye, eine aus verschiedenen Beziehungen Springsteens kombinierte Figur – zu Bruce‘ Rettung nicht beitragen darf.
Seine Reise durch die USA nach Kalifornien wird eine in den Zusammenbruch. Er sieht das neue, weiße Amerika, das nur lose auf dem alten Amerika sitzt -wie ein Provisorium, bereit, vom Wind verweht zu werden.
Der Film ist kein Heldenlied, sondern eine Coming-of-Artist-Geschichte
Als der Film entstand, war Springsteen noch nicht der rang erste Rock-n-Roll-Widerständler, der gegen einen US-Präsidenten Stellung bezieht, der zuhause Hass sät, Menschen jagen lässt und die Demokratie zerreißt. Der Film ist kein Heldenlied, kein Denkmal, sondern – auch wenn es Momente gibt, die hart am Kitsch langschrammen – eine bewegende Coming-of-Artist-Geschichte.
Ein Film – für Springsteen, Springsteen-Fans, für Amerika und die Freiheit der Kunst. Ohne „Nebraska“, das lässt sich beim Abspann ahnen, wäre die Musik dieses großen Storytellers und Rockers immer gleicher und kleiner geworden.
„Springsteen: Deliver Me From Nowhere“, Regie: Scott Cooper, mit Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Stephen Graham, 120 Minuten, FSK 12