Kinder und Jugendliche sollten mehr mitreden und mitgestalten können. Ein Plädoyer zum Start der neuen Teilhabe-Serie von „wir helfen“.
Mitbestimmung„Teilhabe ist kein Anspruch, sie ist ein Menschenrecht“

Kinder und Jugendliche haben ein gesetzlich verbrieftes Recht darauf, mitzureden und mitzubestimmen.
Copyright: imago images/ThomasxKrych
„Bevor junge Menschen die mitreden, sollen sie erstmal was leisten“; „Die haben doch keinen Sachverstand“; „Sie hängen nur in der digitalen Welt herum, und wissen gar nicht, wie das wahre Leben funktioniert“. Geht es um das Thema Teilhabe und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen, prägen noch immer große Skepsis und viele (Fehl-)Annahmen die öffentliche Debatte.
Dabei ist Teilhabe nicht etwa einer Anspruchshaltung von vermeintlich „größenwahnsinnigen“ Teenagern geschuldet, sondern ein international wie national gesetzlich verbrieftes Recht. Es leitet sich aus der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 ab, der inzwischen 192 Staaten beigetreten sind und die in 54 Kapiteln wesentliche Standards festlegt, die den Schutz, die Förderung und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen weltweit garantieren sollen.
Guter Start, gute Entwicklung
Die vier elementaren Grundsätze, auf denen das Übereinkommen beruht, beziehen sich auf das Überleben und die Entwicklung der Kinder, die Nichtdiskriminierung, die Wahrung ihrer Interessen sowie die Teilhabe. Kinderrechte sichern Kindern, die besonders schutzbedürftig sind und andere Bedürfnisse als Erwachsene haben, grundlegende Freiheiten und beste Bedingungen für ihre Entwicklung zu.
Hierzulande trat die Kinderrechtskonvention im Jahr 1992 in Kraft. Sie hat den Rang eines Bundesgesetzes und verpflichtet Deutschland dazu, die niedergeschriebenen 41 konkreten Kinderrechte zu achten, darüber zu informieren und sie umzusetzen.
Teilhabe: Kein Anspruch, sondern Menschenrecht
Artikel 12 und 13 der UN-Kinderrechtskonvention sichern Kindern das Recht auf eine eigene Meinung, Mitbestimmung und Teilhabe zu, und sie verpflichten die beteiligten Staaten, die Meinung junger Menschen in allen Angelegenheiten, die sie betreffen, zu berücksichtigen. Das beinhaltet auch das Recht, dass Kinder und Jugendliche in Gerichts- und Verwaltungsverfahren angehört werden – direkt oder durch eine Vertreterin, beziehungsweise einen Vertreter.
Darüber hinaus regelt das Deutsche Sozialgesetzbuch in Kapitel VIII (§ 8) die Mitwirkung junger Menschen in der Jugendhilfe, und kommunale Regelungen ermöglichen beispielsweise die Einrichtung von Jugendparlamenten oder Jugendvertretungen. So viel zu rechtlichen Aspekten.
Gehört, respektiert, wertgeschätzt
Bleibt die Frage, wofür Teilhabe genau steht und welchen Zweck sie erfüllen soll. Teilhabe bedeutet, das eigene Leben gestalten, selbst Entscheidungen treffen, mitreden und mitbestimmen zu können, wenn es um das eigene Umfeld und die eigene Zukunft geht. Psychologen und Pädagoginnen sind sich längst einig: Die Teilhabe von Kindern, also die Tatsache, dass sie gehört, respektiert und wertgeschätzt werden, stärkt deren Selbstwertgefühl, fördert wichtige emotionale und soziale Kompetenzen wie Empathie, Rücksichtnahme und Kooperationsfähigkeit.
Kinder lernen dadurch, ihre Bedürfnisse und Meinungen zu artikulieren, Verantwortung zu übernehmen und sich aktiv für ihre Rechte einzusetzen, sich in die Gesellschaft einzubringen – was ihre Entwicklung zu selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützt. Und auch die Gesellschaft profitiert davon, denn die Beteiligung von jungen Menschen trägt dazu bei, Vorurteile und Barrieren abzubauen und eine Gesellschaft zu fördern, in der alle Menschen gleichberechtigt teilhaben können.
Über das Anders-Sein austauschen
Für die Philosophin Hannah Arendt fängt Politik dort an, wo Menschen ihr alltägliches Miteinander regeln und sich dabei über ihr Anders-Sein austauschen. Damit Gemeinschaften einem demokratischen Anspruch gerecht werden, müssen also alle Mitglieder die Möglichkeit haben, ihrem Standpunkt und ihren Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen. Auch die Kleinsten. Wenn dagegen Kinder keine Möglichkeit zur Teilhabe haben, entstehen Lücken in der Gestaltung von Angeboten, die ihre Lebenswelt betreffen. Gerade für junge Menschen mit einer Behinderung ist die Teilhabe an der Gesellschaft teilweise stark eingeschränkt, weshalb ihnen besondere Unterstützungsangebote zur Verfügung gestellt werden müssen.
Die Welt entwickelt sich schnell, die Schule nur sehr, sehr langsam. Schule ist dafür da, Basics zu lehren und uns auf die Zukunft vorzubereiten. Im Unterricht lernen wir aber viele Dinge, die man nicht für die eigene Zukunft braucht. Von anderen lebenswichtigen Dingen – von Steuererklärungen über Altersvorsorge bis hin zu Bewerbungen oder gesundem Lebensstil – erfahren wir nichts. Schule muss näher am Leben sein
Junge Menschen interessieren sich genau wie Erwachsene für vielfältige Themenfelder und sind bereit, sich dafür einzusetzen. So engagieren sich in Deutschland mehr als die Hälfte aller 14 – bis 25-Jährigen ehrenamtlich für das Gemeinwohl – und damit mehr als Erwachsene, von denen rund 37 Prozent ehrenamtlich aktiv sind. Da Kinder und Jugendliche aber meist andere Bedürfnisse haben, als Erwachsene, müssen diese berücksichtigt werden, damit zu verschiedenen Themen Lösungen für alle gefunden werden.
(K)ein Recht auf Teilhabe
Dafür müssen junge Menschen beteiligt werden. Was in der Praxis oft nicht geschieht. Kinder und Jugendliche können ihr Recht darauf, teilzuhaben und mitzuentscheiden auch hierzulande noch immer nur begrenzt umsetzen, was der „Teilhabeatlas“ von 2024, die aktuelle Bertelsmann-Studie „Bedarfe von Kindern und Jugendlichen für ein gelingendes Aufwachsen“ und die Begleitstudie „Mit uns!“ vom Jugendexperten-Team der Bertelsmann Stiftung, deutlich aufzeigen. Die teils jugendlichen Autorinnen und Autoren nennen dafür ganz unterschiedliche Gründe.
Ein Problem sei, dass Kinder und Jugendliche oft nicht als zentrale Akteure ernst genommen, von der Politik, aber auch im täglichen Umfeld unterschätzt würden, weil beim Gros der Bevölkerung weiterhin das Bild des bedürftigen und gefährdeten Kindes dominiere, dessen Interessen Erwachsene zu vertreten haben. Adultismus nennt man diese Haltung, wenn Erwachsene meinen, mehr zu wissen und daraus das Recht ableiten, über junge Menschen zu bestimmen.
Zudem seien Teilhabe und Beteiligungsformen von Kindern und Jugendlichen vom Willen und den Ressourcen engagierter Erwachsener abhängig – und müssten altersgerecht angewandt sowie pädagogisch begleitet werden. Kurzum: Es braucht erwachsene Professionelle, die Lust und Zeit haben, Kinder zu beteiligen. Nicht zuletzt müssen Kinder, um ihre Rechte aktiv einfordern zu können, sie auch kennen – und darüber informiert werden.
So gelingt echte Mitbestimmung
Was muss passieren, damit die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen auch in unserem Land selbstverständlich und strukturell verankert wird? Die – auch jugendlichen – Autorinnen und Autoren der genannten Studien, schlagen folgende Lösungswege vor: Als wichtigste Voraussetzung müsse ein Paradigmenwechsel in der Politik stattfinden, denn ohne Veränderung auf politischer Ebene könnten Bestrebungen auf anderen Ebenen nicht fruchten. Teilhabe von Kindern und Jugendlichen dürfe sich, so der Appell, nicht nur auf eine Politik für Kinder beschränken, sondern sei gemeinsam mit Kindern zu gestalten. Dafür müssten junge Menschen an politischen Debatten beteiligt werden, womit ihren Interessen mehr Gewicht verliehen würde und sie erfahren könnten, dass sie in der Lage sind, etwas zu bewirken.
Eine zweite wichtige Voraussetzung sei die Möglichkeit der Mitbestimmung bereits in Kitas. Dort verbringen Kinder einen großen Teil ihrer Zeit, weshalb es Lern- und Lebensorte sein müssten, an denen sie mitgestalten und mitentscheiden können – zum Beispiel bei der Planung von Tagesabläufen, Lern- und Spielangeboten oder der Raumgestaltung.
Lebensnahe Schulbildung
Auch in den Schulen müsse echte Mitbestimmung selbstverständlich sein – und Schülerinnen und Schüler als Experten ihrer Lebenswelt anerkannt werden. Dazu zähle auch, dass sie über die Lerninhalte mitbestimmen können. So wünscht sich ein Großteil der in den Studien befragten Jugendlichen mehr finanzielle Bildung, digitale und Alltags-Kompetenzen. Von den Lehrkräften erwarten junge Menschen, dass sie über mehr psychologisches und methodisches Wissen verfügen, um Schülerinnen und Schüler individuell fördern, deren Stärken und psychische Gesundheit stärken zu können.
„Die Welt entwickelt sich schnell, die Schule nur sehr, sehr langsam. Doch wenn in Schulen an alten Methoden festgehalten wird, entstehen Probleme. Schule ist dafür da, Basics zu lehren und uns auf die Zukunft vorzubereiten. Im Unterricht lernen wir aber viele Dinge, die man nicht für die eigene Zukunft braucht. Von anderen lebenswichtigen Dingen – von Steuererklärungen über Altersvorsorge bis hin zu Bewerbungen oder gesundem Lebensstil – erfahren wir nichts. Schule muss näher am Leben sein“, fordert der Jugendexpertenrat der Bertelsmann Stiftung.
Mehr Respekt vor kindlicher Meinung
Um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, brauche es darüber hinaus mehr finanzielle Unterstützung vor allem für Kinder aus einkommensschwachen Familien. Weshalb die Experten eine Kindergrundsicherung fordern. Darüber hinaus sollten für alle jungen Menschen ein freier Nahverkehr, kostenlose Museumsbesuche und erschwingliche Sportangebote bereitstehen – ohne Anträge oder andere bürokratische Hürden. Was last but not least jede und jeder von uns tun kann, um Kindern und Jugendlichen Mitbestimmung zu ermöglichen? Respekt vor der kindlichen Meinung haben – und sie als Bereicherung verstehen!
So können Sie helfen
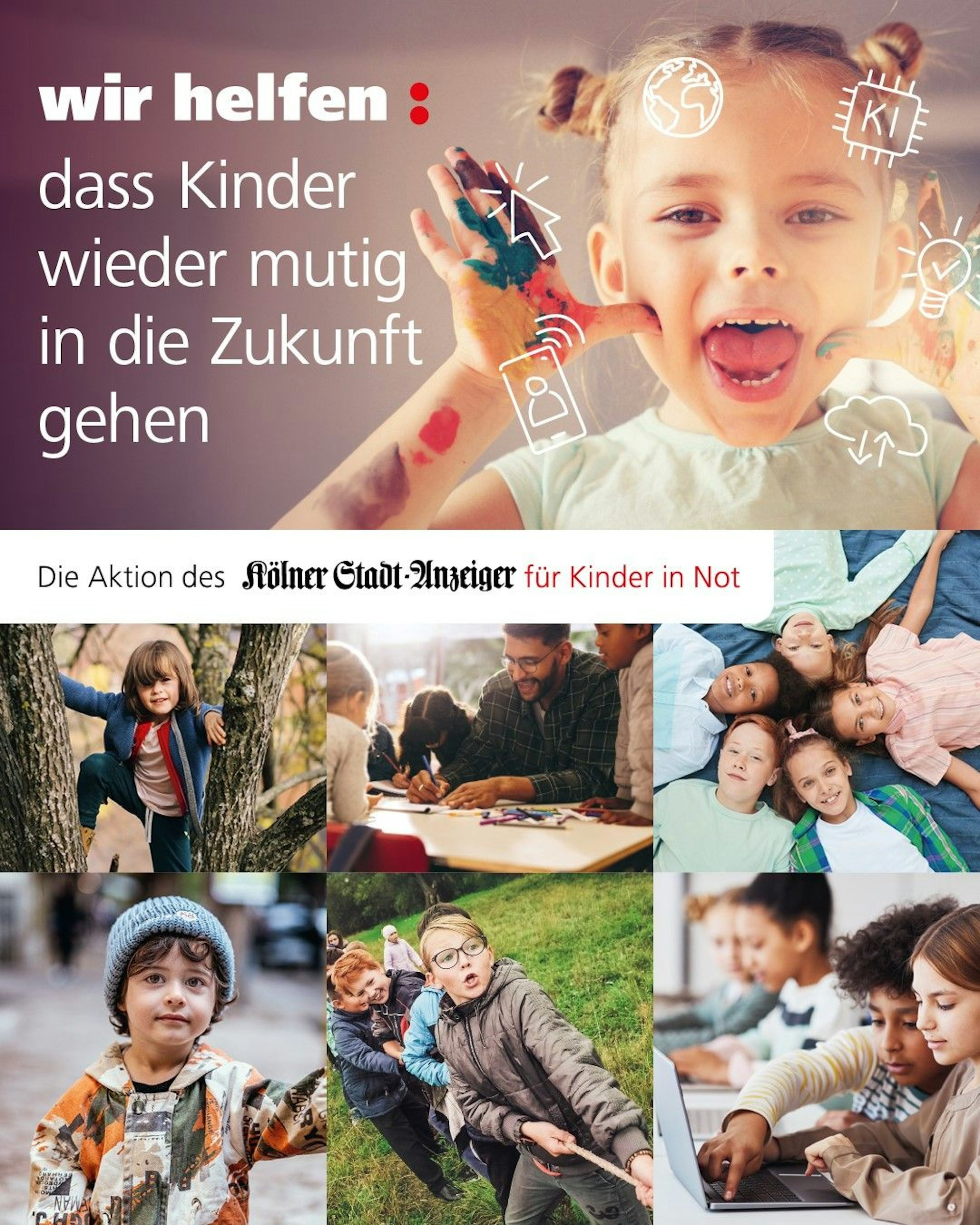
Copyright: Agentur Malzkorn
- Mit unserer neuen Jahresaktion „wir helfen: dass Kinder wieder mutig in die Zukunft gehen“ bitten wir um Spenden für Projekte und Initiativen in Köln und der Region, die vor allem benachteiligten Kindern und Jugendlichen zu einer motivierenden Zukunftsperspektive verhelfen und die Kompetenzen, die sie dafür brauchen, fördern und stärken. Damit jeder junge Mensch eine Chance hat!
- Die Spendenkonten lauten: wir helfen – Der Unterstützungsverein von M. DuMont Schauberg e. V.
- Kreissparkasse Köln, IBAN: DE03 3705 0299 0000 1621 55
- Sparkasse Köln-Bonn, IBAN: DE21 3705 0198 0022 2522 25
- Wünschen Sie eine Spendenbescheinigung, geben Sie bitte +S+ im Verwendungszweck an. Sollten sie regelmäßig spenden, ist auch eine jährliche Bescheinigung möglich. Bitte melden Sie sich hierzu gerne per E-Mail bei uns. Soll Ihre Spende nicht veröffentlicht werden, notieren Sie +A+ im Verwendungszweck. Möchten Sie anonym bleiben und eine Spendenbescheinigung erhalten, kennzeichnen Sie dies bitte mit +AS+.
- Bitte geben Sie in jedem Fall auch immer ihre komplette Adresse an. Auch wenn Sie ein Zeitungsabonnement der „kstamedien“ beziehen, ist Ihre Adresse nicht automatisch hinterlegt.
- Sollten Sie per PayPal spenden, beachten Sie bitte, dass Ihre Spende immer anonym ist. Wünschen Sie eine Spendenbescheinigung schicken Sie eine E-Mail an uns.
- Sollten Sie anlässlich einer Trauerfreier, einer Hochzeit oder eines Geburtstags zu einer Spendenaktion aufzurufen, informieren Sie uns bitte vorab per E-Mail über die Aktion. Sehr gerne lassen wir Ihnen dann, zwei Wochen nach dem letzten Spendeneingang, die gesammelte Spendensumme zukommen.
- Kontakt: „wir helfen e.V.“, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, Telefon: 0221-224-2789 (Allgemeines, Anträge, Regine Leuker), 0221-224-2130 (Redaktion, Caroline Kron), wirhelfen@kstamedien.de
- Mehr Infos und die möglichkeit, online zu spenden finden Sie auf unserer Vereinshomepage hier >>

