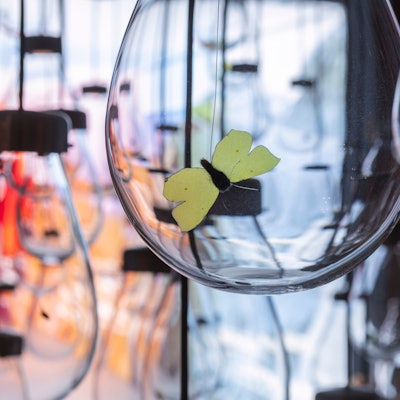Die Architekten Jens Jakob Happ und Tom Bergevoet diskutierten in der Kölner Stadtbibliothek über die Zukunft des Bauens in Zeiten der Klimakrise.
„Eine Stunde Baukultur“Können wir uns heute noch erlauben, Neues zu bauen?

Auf der Fläche des ehemaligen Wendehammers am Hermeskeiler Platz in Sülz realisierte der Frankfurter Architekt Jens Jakob Happ bezahlbare Mietwohnungen für die Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH. Das Ensemble wurde als eine der „Wohnbauten des Jahres 2024“ ausgezeichnet.
Copyright: Annika Feuss
Wie kann Baukultur nachhaltiger werden? Das ist – angesichts der Tatsache, dass das Bauwesen eine der größten Treiber des Klimawandels ist – die wortwörtlich brennendste Frage in der aktuellen Architekturdebatte. Die Probleme und Herausforderungen sind zahlreich und komplex, ebenso wie mögliche Lösungsansätze. Das zeigte auch der gestrige Abend zum Thema zukünftiges Bauen, den das Haus der Architektur Köln (hdak) im Interim der Kölner Stadtbibliothek ausrichtete.
Die beiden Architekten Jens Jakob Happ und Tom Bergevoet diskutierten über „Nachhaltige Visionen für öffentliche Räume als Dritter Ort“, moderiert von Eva Kraus, der Intendantin der Bundeskunsthalle Bonn, die sich dem Thema aktuell mit der Ausstellung „WeTransform“ aus musealer Sicht widmet. Neben dem öffentlichen Raum drehte sich vieles auch um die drängenden Probleme im Wohnungsbau und die Frage, was Nachhaltigkeit – ein durchaus dehnbarer Begriff – überhaupt bedeutet.
Schöne Architektur als nachhaltige Architektur
Happ plädiert etwa dafür, dass Ästhetik und Gestaltung zentrale Aspekte dieser Frage sein sollten. Das Naturkapital sei gebunden an Beton, in Ziegel und Stahl. Deshalb sollten Häuser langlebiger gebaut werden, wieder auf Dauer ausgelegt sein, nicht – wie heute üblich – nach 20 bis 30 Jahren wieder abgerissen werden, so der Frankfurter Architekt und Stadtplaner, der dort seit 2007 dem Städtebaubeirat angehört und Teil des wissenschaftlichen Beirats des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst ist. Es sei notwendig, die gebaute Umwelt wieder bewusst zu gestalten, betont Happ, und den Anspruch auf gute Gestaltung nicht zu verlieren, auch wenn es im Wohnungsbau gerade vor allem schnell und bezahlbar sein soll.
Langlebige Gebäude und städtebauliche Lösungen zu entwerfen, daran ist auch der Niederländer Tom Bergevoet interessiert, der in Amsterdam das Büro „Temp.architecture.urbanism.“ führt. Für ihn steht allerdings weniger ein ästhetischer Diskurs, als die praktische Umsetzung im Fokus. In seinem Handbuch „The flexible City“ (NAI, 2024) fordert er Umstrukturierung, Nachverdichtung und Aufwertung bestehender Stadträume statt Erweiterung, Transformation statt Expansion. „Die Frage ist, ob wir uns in einer Situation befinden, in der wir als Architekten den Luxus haben, Ideen für neue Gebäude zu entwickeln“, so Bergevoet, „oder ob wir uns besser mit dem Bestehenden arrangieren sollten, auch mit dem gesamten Erbe der Moderne.“ Der Architekt verweist auf das Pariser Klimaabkommen, laut dem wir keine ganzen Gebäude mehr abreißen dürften. Deshalb findet er, sollten wir mit dem baulichen Erbe arbeiten, das wir in den Städten vorfinden, auch mit den eher unliebsamen Gebäuden.
Kreislauf statt Wegwerfmentalität
Aktuell wird in Amsterdam ein Projekt Bergevouts umgesetzt, das Park und Wohnungsbau vereinen und das naturnahste Wohnviertel der Niederlande werden soll. Seine Gebäude versteht er innerhalb der Stadt nicht als letzten Schritt, sondern als Teil eines Prozesses. Deshalb ist sein Anspruch, das zirkuläre Bauen – bei dem in einer Kreislaufwirtschaft gedacht wird, um Abfall möglichst zu vermeiden.
Wir müssen begreifen, dass Bauen kein Vorgang des Konsumierens ist, sondern auf Dauer angelegt sein sollte.
Bauen, so Jens Jakob Happ, sei seit der Nachkriegszeit immer stärker zu einem Verbrauchsgegenstand geworden. Gebäude werden verbraucht, abgerissen und ersetzt. „Das ist eine Kultur der Wegwerfmentalität. Wir müssen begreifen, dass Bauen kein Vorgang des Konsumierens ist, sondern auf Dauer angelegt sein sollte und dazu gehört beispielsweise auch das Reparieren.“ Auch das Wiederverwerten von Baumaterialien wird immer wieder als nachhaltige Architekturpraxis vorgeschlagen. Doch während in der Schweiz bereits erste Projekte aus wiederverwerteten Bauteilen umgesetzt werden, scheitern solche Vorhaben in Europa aktuell noch an zu strengen Bauvorgaben und Regularien, wie Happ betont. In dem von ihm herausgegebenen Buch „Für eine nachhaltige Architektur der Stadt“ (Wagenbach Verlag, 2025) findet auch die Frage nach alternativen Bautechniken Platz. Die Architektin Anna Heringer etwa, gilt vor allem wegen ihrer zeitgenössischen Lehmbauten als Vorreiterin des nachhaltigen Bauens.
An Lösungsideen – das zeigte bereits die Ausstellung in der Bundeskunsthalle sehr eindrücklich – mangelt es definitiv nicht. Damit diese allerdings auch in der Breite umgesetzt werden können, bedarf es anderer politischer Rahmenbedingungen, wie Eva Kraus an diesem Abend immer wieder hervorhebt. Es brauche Veränderungen sowohl auf politischer, als auch auf sozialer und kultureller Ebene – und ein gesellschaftliches Umdenken sei gefragt. Das sieht auch Bergevout so: „Wenn wir umbauen, statt neu bauen, kann nicht mehr jedes Gebäude brandneu aussehen. Diese Veränderung in der Denkweise, muss sich in den Köpfen der Menschen festsetzen: Wenn wir unseren Planeten retten wollen, wird nicht mehr alles neu sein.“
NEUVERORTUNG ist ein Format der Stadtbibliothek Köln, das mit Unterstützung des Königreichs der Niederlande und in Kooperation mit dem Haus der Architektur (hdak) im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Jeden Dienstag 19 Uhr eine Stunde Baukultur“ organisiert wird.