Seine Musik ließ einst Orchester rebellieren, heute gilt er als einer der bedeutendsten Komponisten unserer Zeit. Zum 90. Geburtstag von Helmut Lachenmann.
Zum 90. Geburtstag von Helmut LachenmannKunst als „Verweigerung des Gewohnten“
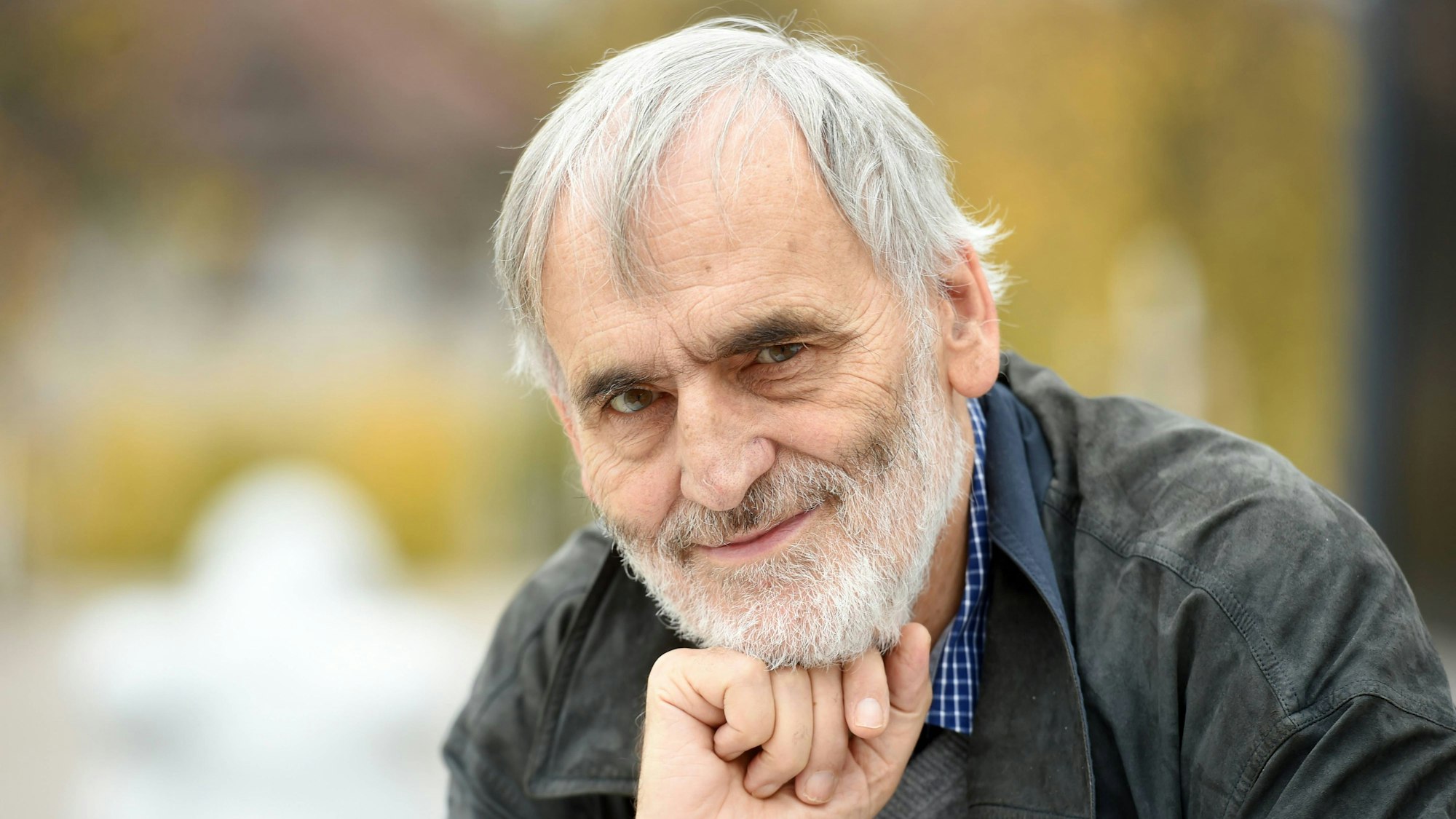
Komponist Helmut Lachenmann, 2015. Größere Bekanntheit erlangte er mit seiner Oper „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ nach Christian Andersen.
Copyright: imago/Zentrixx
Bereits Anfang der 2000er Jahre nannte er sich selbst einen „Dinosaurier“, der inmitten einer rapide veränderten Kultur-, Medien- und Musiklandschaft an Idealen festhält, welche die Titel seiner Schriften „Musik als existentielle Erfahrung“ (1996) und „Kunst als vom Geist beherrschte Magie“ (2021) umreißen. Kategorien wie Werk, Autorschaft, Autonomie und Freiheit der Kunst bestimmen das Schaffen des am 27. November 1935 in Stuttgart geborenen Komponisten. Nun wird Helmut Lachenmann 90 Jahre alt. Diesen Anlass feiert das Ensemble Modern Orchestra am 19. November in der Kölner Philharmonie mit einer Aufführung von Lachenmanns 2005 uraufgeführtem Ensemblewerks „Concertini“.
Als Schüler von Luigi Nono in Venedig wurde Lachenmann Ende der 1950er Jahre auf Genauigkeit im Umgang mit dem musikalischen Material und dessen Strukturierung eingeschworen. Das serielle Parameterdenken der Nachkriegsavantgarde erweiterte er allerdings um Aspekte, die beim Musikhören ebenso entscheidend sind wie Tonhöhen, Dauern, Schallstärken. Mit seinem Ansatz der „musique concrète instrumentale“ lenkte er Ende der 1960er Jahre das Augen- und Ohrenmerk auf die physischen, expressiven und auratischen Bedingungen der Klänge. Er rückte diejenigen instrumentalen und vokalen Energien, mechanischen Aktionen, physischen Körperteile und Baumaterialien in den Vordergrund, die für jede Hervorbringung von Schall unerlässlich sind, aber beim traditionell philharmonischen Wohlklang unterdrückt werden.
Erstickte, gepresste, geknarzte, geschlagene und gehauchte Klänge
Klänge sollten nicht einfach als schön oder hässlich, sauber oder unrein gewertet werden, sondern zunächst einmal die konkreten Bedingungen ihrer Erzeugung offenlegen. Lachenmann entwickelte dafür neue Spieltechniken und Notationsweisen. Im Solostück „Pression“ für einen Cellisten (1969/70) demonstriert er, was der Stücktitel benennt: verschiedene Verhältnisse von Druck und Bewegung von Bogen- und Griffhand auf unterschiedlichen Bauteilen des Instruments. Als eine Spielmöglichkeit im breiten Spektrum verschiedenster Geräuschklänge erscheint auch die konventionelle Tongebung. Lachenmann ging es um Kunst als „Verweigerung des Gewohnten und des Verdinglichten“, damit man die besondere Schönheit dieser Klangwelt wahrnimmt. Zugleich wollte er die übliche Musikpraxis und Tradition kritisch befragen und neu beleuchten.
Alles zum Thema Kölner Philharmonie
- Meistgelesen 2025 Gebrechen, Einsamkeit, Sorgen? Diese Senioren singen sich glücklich
- Budapest Festival Orchestra in der Philharmonie Überzeugendes Plädoyer für einen wenig gespielten Strauss
- Lahav Shani in der Philharmonie Anti-Israel-Proteste überschatten Konzert
- Lukas Sternath in der Kölner Philharmonie Ein junger Klavierlöwe zeigt, was er kann
- Kölner Philharmonie Cecilia Bartoli und Lang Lang als Dreamteam
- Jubiläum Unlimited Voice Company aus Chorweiler feiert 30 Jahre auf großen und kleinen Bühnen
- Kölner Philharmonie So klingen Sebastião Salgados Urwald-Visionen
Sein radikales erstes Streichquartett „Gran Torso“ (1971), dem zwei weitere folgten, stellte er bewusst in die Gattungstradition. Nach dem Motto „Komponieren heißt: Ein Instrument bauen“ kreierte er eine Fülle erstickter, gepresster, geknarzter, geschlagener und gehauchter Klänge auf allen möglichen Bauteilen, sodass die traditionelle Besetzung kaum wiederzuerkennen ist. Darüber hinaus folgt das Stück wie ein Quartett von Beethoven erkennbaren Prozessen von Verarbeitung, Durchführung, Polyphonie und Konzertieren. In der Musik für einen Soloklarinettisten mit Orchester „Accanto“ (1975/76) lässt Lachenmann eine Aufnahme von Mozarts Klarinettenkonzert fragmentiert zuspielen. Die Zitate verkörpern sowohl das klassische Schönheitsideal als auch den Ausverkauf der Klassik als Kitsch und bloße Wohlfühlmusik. In Kontrast dazu schnauft Lachenmanns Solist tonlos und zuweilen „schweineartig“ in das mundstücklose Instrument.
Musik mit gesellschaftspolitischen Implikationen
Lachenmann hegt die Hoffnung, dass seine über ihre eigenen materialen Bedingungen und gesellschaftlichen Kontexte nachdenkende Musik auch auf allgemeine Bedingungen des Musikmachens, Hörens, Denkens und Handelns verweist. Der Gegenstand von Musik ist für ihn „das Hören, die sich selbst wahrnehmende Wahrnehmung.“ Und solche für die eigenen Mechanismen sensibilisierte Welt- und Selbstwahrnehmung entfaltet auch gesellschaftspolitische Implikationen. Denn wer wahrnimmt, was wirklich klingt, wird womöglich in die Lage versetzt, die erkannten realen Verhältnisse gegebenenfalls auch zu verändern. Unter dem Begriff „ästhetischer Apparat“ reflektierte Lachenmann die Gesamtheit dessen, was die Herstellung, Verteilung und Wahrnehmung von Musik beeinflusst und sowohl das Verlangen der Menschen nach dem Schönen, Guten, Wahren befriedigt als auch das Bedürfnis nach Berieselung, Vergessen und Weltflucht.
Lachenmanns Musik ließ einst Orchester rebellieren und Publikum türenschlagend den Saal verlassen. Inzwischen ist der Komponisten als einer der bedeutendsten unserer Zeit anerkannt. Größere Bekanntheit erlangte er mit seiner Oper „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ nach Christian Andersen, die seit der Uraufführung 1997 in Hamburg vielerorts neu inszeniert wurde. Als Professor für Komposition an der Musikhochschule Stuttgart hatte er eine große Zahl an Schülerinnen und Schülern, die längst das internationale Musikleben bereichern und selbst an Hochschulen im In- und Ausland unterrichten. Nun kann man in Köln erleben, wie die verschiedensten Instrumente des großbesetzten Ensembles in seinen „Concertini“ auf ganz neue Art miteinander konzertieren.
Helmut Lachenmann zum 90. Geburtstag, 19. November, um 20 Uhr in der Kölner Philharmonie, mit dem Ensemble Modern, IEMA-Ensemble und Sylvain Cambreling. Tickets unter koelner-philharmonie.de


