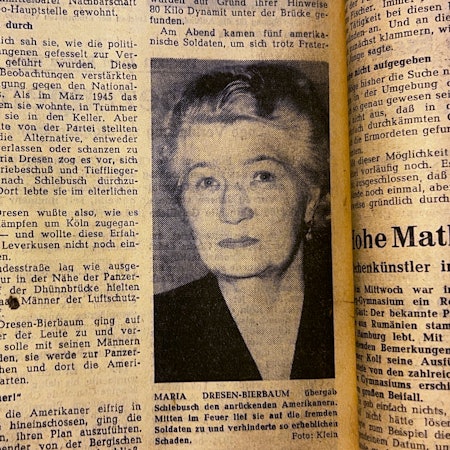15 Tage nach der Kapitulation am 23. Mai 1945 trat zum ersten Mal nach dem Krieg ein Vorläufer des Stadtrats zusammen und ging Probleme an.
Nachkriegszeit 1945Nach der Befreiung wurde es in Leverkusen noch einmal gefährlich

Das Aufräumen dauerte: Dieses Bild entstand am 17. Mai 1947 in Wiesdorf in der Hauptstraße.
Copyright: Stadt Leverkusen
In der Zeit kurz nach der Befreiung Leverkusens durch die Amerikaner mussten zuerst Ordnung in die Ämter und die Strukturen gebracht werden. Die Befreiung war im Wesentlichen am vorherigen Sonntag, 15. April 1945, gelaufen. Die Amerikaner sollen zuerst nicht gewusst haben, dass die Ansammlung der verstreut liegenden Dörfer Wiesdorf, Schlebusch und Küppersteg verwaltungstechnisch zusammengehörten. Sie sollen sogar den alten Bürgermeister Ludwig Simon mit der NSDAP-Parteimitgliedschaft im Amt belassen haben. Ruhe in den Dörfern war da wohl erstmal wichtiger, mögen sie gedacht haben.
In den Monaten um das Kriegsende herum und lange danach erschienen keine Zeitungen. Erst später wurden die Geschehnisse vom Autor Barthold Strätling aufgeschrieben, der schreibt, er habe zeitnah die Geschehnisse recherchiert und hauptsächlich mit Augenzeugen gesprochen, bevor er seine Serien 1958 im „Leverkusener Anzeiger“ veröffentlichte. Überprüfen können wir diese Angaben allerdings heute kaum noch. Er schreibt, dass die Soldatenmannschaft der ersten Welle schon zwei Tage nach der Eroberung der Stadt weitergezogen sei. Danach sei eine kurze, regellose Zeit angebrochen.
Die eigenen Soldaten waren gefährlich für die Bevölkerung
Zwei Tage lang sollen versprengte deutsche Soldaten von der Bevölkerung Zivilkleidung gefordert haben, in der Hoffnung, einer Gefangenschaft zu entgehen. Von ihnen sei auch Gewalt ausgegangen, schreibt der Autor. Und dass plötzlich die Verhältnisse auf den Kopf gestellt worden seien: Zwangsarbeiter aus Osteuropa, die lange Zeit für die Deutschen in den Fabriken schuften, leiden und sterben mussten, hätten sich gerächt. „Mancher Leverkusener dankte nach deren Abzug dem Herrn, dass er nicht erschlagen worden war“, schreibt Strätling.
Alles zum Thema Opladen
- Neueröffnungen und Traditionslokale Gastro-Tipp Leverkusen: Hier können Sie essen gehen
- Haushalt, Abfall, Schwarzfahren Das hat der Leverkusener Stadtrat entschieden
- Klimakrise Leverkusener Schüler schicken 26.000 Grüne Meilen nach Belém
- Limbach-Plan Arbeitsgericht in Leverkusen soll Strukturreform überleben
- Querdenker-Veranstaltung Umstrittener Schweizer Verleger tritt im Opladener Scala auf
- Gebäudebestand Zahl der Wohnungen in Leverkusen wächst sehr langsam
- Evangelische Gemeinde Bielertkirche in Opladen von außen saniert – Innenausbau bis 2027

1945 sah die Bahnhofstraße in Opladen so aus.
Copyright: Stadt Leverkusen
Bürgermeister Simon, der seit 1938 die Verwaltung geleitet hatte, enthob der amerikanische Kommandant am 20. April seines Amtes und setzte den SPD-Mann August Adolphi für 27 Tage ein. Danach musste Heinrich Claes von der Zentrumspartei noch einmal ran, er war schon von 1921 bis 1930 Bürgermeister von Küppersteg gewesen; nach der Stadtgründung 1930 war er drei Jahre lang Leverkusens erster Bürgermeister gewesen. 1933 war er vorzeitig von seinem Nachfolger, dem Nazi Wilhelm Tödtmann, aus dem Amt gedrängt worden. Nach Claes ist eine Straße in Küppersteg benannt.
Der NS-Bürgermeister kam in Haft
Bürgermeister Simon wurde verhaftet und soll im Internierungslager für Nazi-Funktionäre einige Kollegen getroffen haben, schreibt der Serienschreiber Strätling. Noch hatte Deutschland nicht kapituliert, aber Leverkusen war schon befreit.

Die Breidenbachstraße in Wiesdorf 1947.
Copyright: Stadt Leverkusen
In der Folge durchsuchen, „filzen“ die Amerikaner Leverkusener Häuser nach Soldaten und Waffen. Wer verdächtig ist oder ein Nazi, kommt sofort in ein Lager am Mauspfad und von dort mit großen Sattelschleppern zu Hunderten weiter in die überregionalen Kriegsgefangenenlager.

1945: Das stark zerstörte Tor Pförtner IV, Bayerwerk
Copyright: Bayer AG
Die Straßen sollen verheerend ausgesehen haben: Nicht Schlaglöcher, sondern über 170 Bomben- und Granatkrater soll es in Leverkusens Straßen gegeben haben, 55 Treffer hatten Kanäle abbekommen. Die einzelnen Stadtteile waren teils voneinander getrennt: Viele Brücken waren zerstört, etwa die alte Brücke über die Eisenbahn zwischen Wiesdorf und Küppersteg. Die Autobahn endete in Küppersteg, die Autobahnbrücke über die Dhünn war unbenutzbar. Man ging daran, Notstege zu bauen.

Die Kirche Sankt Remigius 1945.
Copyright: Stadt Leverkusen
Ein erstes Stadtverordnetenkollegium, ein Vorläufer des Rats, tagte vor 80 Jahren am 23. Mai. Hauptthema: Wie kann der Schutt geräumt werden? Es sollen 60.000 Kubikmeter gewesen sein. Wie können Wasser- und Stromleitungen instandgesetzt werden? Wie die Gasleitungen? Die sollen an über 50 Stellen schwer beschädigt gewesen sein. Dennoch soll schon im Juli 1945 wieder Gas geströmt sein.
Der Nazi Robert Ley verlor schnell die Leverkusener Ehrenbürgerwürde
Der erste Rat war von den Amerikanern eingesetzt worden, die ziemlich genau gewusst haben sollen, welche Nazi-Gegner sie dafür rekrutieren konnten. Der Verleger und Buchhändler Friedrich Middelhauve war dabei, er gründete später im Opladener „Hotel zur Post“ (jetzt „Woolworth“) die FDP mit. Eine richtige Wahl gab es erst später. Dieser erste Rat entzog dem Ex-Leverkusener und Bayer-Chemiker Robert Ley die Ehrenbürgerwürde. Ley, der schon 1923 NSDAP-Mitglied geworden war, leitete später die Deutsche Arbeitsfront, die nach der Zerschlagung der Gewerkschaften die Arbeiter führen sollte. Ley wird von dem Entzug durch den Rat noch erfahren haben, denn er war zu der Zeit in Nürnberg in Haft, im Oktober 1945 beging er dort Suizid.
Die Bevölkerung unmittelbar war ganz anderen Gefahren ausgesetzt als heute. Auf den wegen der Nahrungs- und besonders Fleischknappheit seien auf Höfen Wachdienste eingerichtet worden, das Gut Hummelsheim soll eine eigene Sirene besessen haben, über die man bei drohenden Überfällen die Hofbewohner alarmieren konnte.
Überfall in Hummelsheim
Zu einer Schießerei wie im Wilden Westen soll es dort am 20. Juli 1945 gekommen sein: Bewaffnete Räuber sollen den Verwalter Julius Wienken zuerst nur fast angeschossen haben, als er im Kuhstall nachsehen wollte, ob die Angreifer weg waren, traf ihn ein Schuss, den er nicht überlebte. Auch die Schlebuscher Polizei konnte die bewaffnete Bande nicht besiegen, ihre Flucht gelang.
Sowohl in der Serie als auch der Wiesdorfer Lokalhistoriker Franz Gruß berichteten davon, dass sich sogenannte „Displaced Persons“, Zwangsarbeiter also, jetzt gegen die Deutschen wandten. Ein größeres Lager soll hinter der Siedlung Eigenheim gelegen haben. Diese Menschen hätten in dieser ungeregelten Zeit Banden gebildet. Während der Luftangriff hatten sie meist keinen Zugang zu den Luftschutzkellern, schreibt Gruß, deshalb hätten sie Waffenlager im Wald anlegen können.

Ein Bild der Kölner Straße in Opladen.
Copyright: Stadt Leverkusen
Von der Wiesdorfer Kirche Herz Jesu standen nur noch die Außenmauern, der Pfarrer Klinkenberg, dessen Grab im Hinterhof der Kirche liegt, soll gemeinsam mit Messdienern und Frauen sofort nach dem Einzug der Amerikaner begonnen haben, aufzuräumen und Ziegelsteine vom Mörtel freizuklopfen. Auch das Pfarrheim, über dessen Abbruch derzeit geredet wird, war zerstört und wurde wieder aufgebaut. Viele, schreibt Strätling, hätten selbst viel zu bauen gehabt, aber stundenweise Zeit für den Wiederaufbau der Kirche geopfert. Herz Jesu soll eine der ersten zerstörten Kirchen im Erzbistum gewesen sein, in denen man wieder Gottesdienst feiern konnte.
Spürbar viele Flüchtlinge sollen erst 1946 in Leverkusen eingetroffen sein. Der Krieg war vorüber, amtlich festgestellt wurden 1746 gefallene Soldaten, 1560 Vermisste, darunter 330 Zivilpersonen, 409 Tote durch Bomben. 385 Häuser mit 1131 Wohnungen waren zerstört oder mussten aus statischen Gründen abgebrochen werden.