In Köln stellt man sich hinter das Fairness-Abkommen. Eine Formulierung soll jedoch in Zukunft geändert werden.
Falschberichte und Musk-EinmischungDas steht wirklich im umstrittenen Kölner Fairness-Abkommen zum Wahlkampf

Plakate zur Kommunalwahl in Köln
Copyright: Martina Goyert
Die sogenannte Fairness-Vereinbarung zwischen mehreren demokratischen Parteien in Köln ist derzeit international Thema. Die „Bild“-Zeitung schreibt von einer „bizarren Maulkorb-Vereinbarung“, die „Welt“ unterstellt, Migration bleibe im Kölner Wahlkampf „tabu“, Markus Lanz behauptete am Donnerstag in seiner ZDF-Talkshow: „Alle Parteien verabreden sich darauf, bloß nicht über Migration zu sprechen und wenn ja, ausschließlich positiv.“ Und Tech-Milliardär Elon Musk postete unter eine Schlagzeile mit dem Titel „Kölner Wahl: Nur die AfD darf frei über Migration sprechen“ eine Wahlempfehlung für die Partei.
Gibt es wirklich einen „Maulkorb“? Was regelt die Vereinbarung konkret? Und ist ein solches Abkommen heute noch zeitgemäß? Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hat die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema gesammelt.
Was genau ist die Fairness-Vereinbarung?
Alles zum Thema Elon Musk
- Nach bundesweiter Empörung Kölner CDU will keine Abkommen vor Wahlen mehr unterzeichnen
- Job-Kolumne Warum wir dringend aus der Opferhaltung rausmüssen
- Gehalt bei Zielerfüllung Tesla-Aktionäre billigen Billionen-Paket für Elon Musk
- „Wichtig für die Zivilisation“ Elon Musk startet „Grokipedia“ als Konkurrenz zu Wikipedia
- Känguru-Autor Marc-Uwe Kling „Dagobert Duck würde nicht mal zu den Top 25 der Reichsten gehören“
- Mysteriöser Kalendereintrag Elon Musk will Epsteins Einladung auf seine Insel abgelehnt haben
- „Märtyrer“, „Patriot“ Trump-Lager erinnert bei Trauerfeier an Charlie Kirk – Musk vor Ort
Die Fairness-Vereinbarung verschiedener demokratischer Parteien in Köln ist deutschlandweit in dieser Form einmalig. Wörtlich verpflichten sich die Unterzeichner darin, im Wahlkampf „die Vielfalt in unserer Gesellschaft zu achten“ und sich für ein „friedliches Miteinander der Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Religionen einzusetzen“. Dazu gehöre, „nicht auf Kosten von Menschen mit Migrationshintergrund“ Wahlkampf zu betreiben und „inhaltlich fair zu bleiben“. Außerdem keine Vorurteile gegen Migranten zu schüren oder zu dulden sowie sich aktiv gegen Antisemitismus und Rassismus einzusetzen und „Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge nicht für negative gesellschaftliche Entwicklungen wie die Arbeitslosigkeit oder die Gefährdung der Inneren Sicherheit verantwortlich zu machen“.
Wer hat diese Vereinbarung wann und warum ins Leben gerufen?
Das Papier wurde 1998 seinerzeit vom Verein Kölner Runder Tisch für Ausländerfreundlichkeit angestoßen. „Die Initiative wollte vermeiden, dass die harten Auseinandersetzungen zwischen der Union und vor allem SPD und Grünen in der Asyl- und Migrationspolitik den Wahlkampf zur Bundestagswahl 1998 vergiften“, sagt Wolfgang Uellenberg-van Dawen, Sprecher des Vereins, der inzwischen Runder Tisch für Integration heißt. Zwei Jahre zuvor, 1996, hatte sich in Köln die rechtsextreme Wählergruppe Pro Köln gegründet. Die Fairness-Vereinbarung wird seitdem vor jeder Wahl in Köln neu unterzeichnet, zuletzt vor der Kommunalwahl am 14. September 2025 von CDU, SPD, FDP, den Grünen, der Linken und Volt.
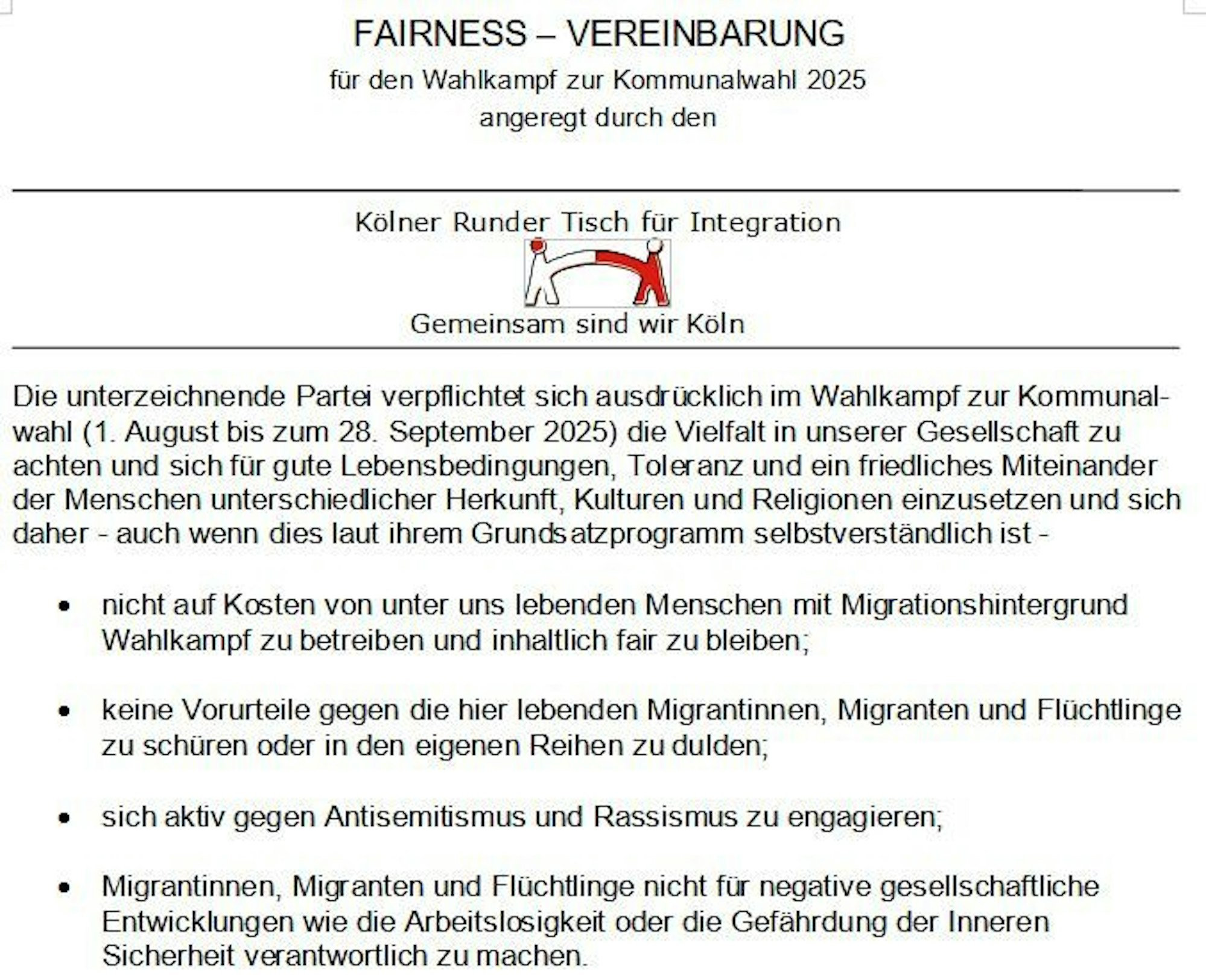
Die sogenannte Fairness-Vereinbarung von 1998 wurde vor dem laufenden Kommunalwahlkampf erneuert.
Copyright: Runder Tisch für Integration
Wenn das Abkommen doch schon 27 Jahre alt ist – warum ist es plötzlich in aller Munde?
Auslöser war ein Wahlkampf-Flyer des Kölner CDU-Ratsmitglieds Florian Weber, der sich kritisch mit der geplanten Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Gebäude der alten Oberfinanzdirektion im Agnesviertel auseinandersetzt. „Nein zur Großunterkunft. Für ein sicheres, lebenswertes Agnesviertel“ steht auf dem Flugblatt. Am 21. August hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ exklusiv darüber berichtet, dass der Runde Tisch und die Grünen in dem Flyer samt Slogan eine Verletzung des Fairness-Abkommens sehen. Andere Medien griffen die Berichterstattung auf, manche gaben sie teilweise arg zugespitzt oder mit verkürztem Zusammenhang wieder.
Eine oft gehörte Kritik ist, die Parteien würden sich mit ihrer Unterschrift verpflichten, nicht schlecht über Migration zu sprechen. Stimmt das?
Nein. Der Runde Tisch selbst schreibt auf seiner Homepage ergänzend zum Wortlaut des Abkommens, es gebe im Wahlkampf keine Diskussionsverbote. Man solle lediglich „inhaltlich fair“ bleiben. Dass auch das Thema Migration und Kriminalität im Kölner Kommunalwahlkampf kontrovers diskutiert werden kann, zeigt das Beispiel des CDU-Flyers: Die Schiedsleute des Runden Tischs, Gregor Stiels vom Katholikenausschuss und Bernhard Seiger, Superintendent der evangelischen Kirche, entschieden, das Flugblatt stelle keinen Bruch des Abkommens dar. Die Vereinbarung bedeute nicht, „dass über die Gestaltung und den Ort der Unterbringung Geflüchteter in unserer Stadt keine politische Auseinandersetzung stattfinden darf“, heißt es in der Stellungnahme. „Es gehört zur demokratischen Auseinandersetzung, dass sachbasiert Lösungswege für strittige Themen diskutiert werden, dazu dient auch der Wahlkampf. Eine Herabwürdigung geflüchteter Menschen findet sich im fraglichen Flyer nach unserer Einschätzung an keiner Stelle.“
Im Fairness-Abkommen steht aber auch, dass Migranten nicht für die Themen Arbeitslosigkeit und Gefährdung der Inneren Sicherheit verantwortlich gemacht werden sollen. Ist das nicht eine Tabuisierung – ein „Maulkorb“, sozusagen?
Diesem Absatz fehle das Adjektiv „pauschal“, meint Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), ehemalige Bundesjustizministerin (1992 bis 1996 und 2009 bis 2013), Antisemitismusbeauftragte in NRW (2018 bis 2024) und Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs (2019 bis 2023), die der „Kölner Stadt-Anzeiger“ um eine Einschätzung gebeten hat. „Keine Gruppe unserer Gesellschaft darf pauschal für Gefährdungen der Inneren Sicherheit, für Terrorismus und Belastung der sozialen Sicherungssysteme verantwortlich gemacht werden“, sagt sie und ergänzt: „Natürlich dürfen die Gefahren nicht verharmlost und müssen auch richtig eingeordnet werden.“ Es sollte aber auch nicht vergessen werden, ergänzt die Politikerin, „dass die Rechtsextremen die größte Gefahr für die Innere Sicherheit darstellen, so bewerten es die Sicherheitsbehörden“.
Claus-Ulrich Prölß, Mitglied des Runden Tischs für Integration und Geschäftsführer des Kölner Flüchtlingsrats, sagt: „Natürlich ist mit dem Satz gemeint, dass Migranten nicht pauschal verantwortlich gemacht werden sollen – 25 Jahre lang ist das auch so verstanden worden. Jetzt ist aufgefallen, dass da ein Wort fehlt. Daraus abzuleiten, dass es einen Maulkorb gibt, um über Integrationsprobleme zu sprechen, ist purer Populismus.“
Die AfD in Köln wurde vor dem Wahlkampf 2025 gar nicht erst gefragt, ob sie dem Abkommen beitreten möchte. Ist das fair?
Der Runde Tisch argumentiert, Menschenwürde und Menschenrechte seien „die Grundlage der Auseinandersetzung auf dem Boden des Grundgesetzes“. Das Grundsatzprogramm der AfD sei das Gegenteil dessen, wofür der Runde Tisch stehe. Darum habe man die AfD auch nicht eingeladen, dem Abkommen beizutreten. Das hätte sie allerdings sowieso nicht getan, sagte OB-Spitzenkandidat Matthias Büschges dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ auf Anfrage.
Braucht es ein Fairness-Abkommen überhaupt? Sind Toleranz und der Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus nicht selbstverständlich für eine demokratische Partei?
Eigentlich sollten Fairness und Toleranz selbstverständlich sein, sagt Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Dennoch hält sie das Abkommen für sinnvoll. Denn „leider ist selbstverständliche Toleranz mit den rechtsextremen Gruppierungen und Parteien nicht mehr gegeben“. In ihren Augen würde eine Einigung auf den Grundsatz „nicht auf Kosten von Menschen mit Migrationshintergrund Wahlkampf zu betreiben und fair zu bleiben“ ausreichen – denn „das umfasst jede Form der Hetze gegen Migrantinnen und Migranten“.
Wolfgang Uellenberg-van Dawen kündigt für kommenden Donnerstag ein Treffen des Koordinierungsausschusses des Runden Tischs für Integration an, um über die Zukunft der Fairness-Vereinbarung zu sprechen. „Wir werden uns dabei auch mit der Fehlerkritik beschäftigen“, sagt Claus-Ulrich Prölß. „Es bedarf sicher Präzisierungen. Im aktuellen Wortlaut wird es das Abkommen sicher nicht mehr geben.“ Wichtiger als ein Gerangel um Adjektive oder Formulierungen sei es indes, „dass die demokratischen Parteien sich weiterhin einig sind, dass Hetze gegen Migranten in Köln keinen Platz haben darf“, so Prölß. Die Fairness-Vereinbarung sei 1998 auch als „Brandmauer gegen Rechtsextremismus“ ins Leben gerufen worden. „Und die braucht es heute mindestens so dringend wie damals.“

