Weihnachten ist das „Fest der Liebe“ – und mehr. Die biblischen Geschichten sind von erstaunlicher Aktualität.
Die Weihnachtsfest-KarriereWie Josef zum Patron der Patchworkfamilie wurde
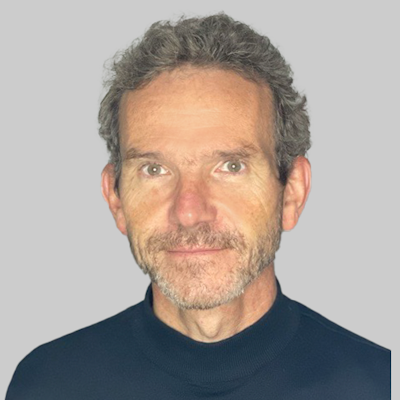

Die „heilige Familie“ taugt auffallend gut als Rollenmodell für das heutige Verständnis der Familie als Verantwortungsgemeinschaft.
Copyright: Midjourney/Janitzki
Das Weihnachtsfest hat eine bemerkenswerte Karriere hingelegt. Den frühen Christen war die Geburt Jesu überhaupt keine eigene Feier wert. Die Konzentration lag ganz auf Tod und Auferstehung des Herrn. Im 4. Jahrhundert kam Weihnachten laut einer gängigen Theorie als christliche Gegenveranstaltung zum Kult des römischen Sonnengottes am Tag der Wintersonnenwende auf. Accessoires wie Krippe, Ochs und Esel sind eine mittelalterliche Erfindung des heiligen Franz von Assisi.
Zum bürgerlichen Fest der Familie wurde Weihnachten im 19. Jahrhundert. Erst damals kam auch das Schenken in Mode. Kritik an Päckchenorgien und Konsumterror gehört dann spätestens seit den 1950er Jahren so untrennbar zu Weihnachten wie das Lametta zum Christbaum.
Dass Weihnachten heute – religiös entkernt, wie der Bonner Philosoph Markus Gabriel es formuliert – als „das“ Fest der Liebe begangen wird, ist der Merry-Christmas-Welle zu verdanken, die aus dem Weihnachtsexportland USA in die Alte Welt zurückgeschwappt ist. Natürlich bietet die christliche Weihnachtsgeschichte einen guten Stoff dafür: Eine junge Frau, Maria, die unter höchst prekären Umständen ihr erstes Baby zur Welt bringt - da geht einem direkt das Herz auf.
Patron der Patchworkfamilie
Allerdings lassen sich die biblischen Erzählungen auch weniger idyllisch lesen, als literarische Verarbeitung von Beziehungskrisen nämlich und von Konflikten, persönlichen wie politischen. Josef zum Beispiel, der Verlobte Marias, wird wenig erbaut davon gewesen sein, dass seine zukünftige Frau auf einmal schwanger ist – von einem anderen. Er will sich denn auch „in aller Stille“ von ihr trennen.
Nobel, befindet der biblische Autor. Während Josef noch darüber nachdenkt, erfährt er von einem Engel im Traum, das Kind sei vom Heiligen Geist. Auch das eine Ansage, die erst einmal verdaut werden will. „Fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen“, sagt der Engel. Und Josef tut, wie ihm geheißen.
So wird er zum Patron der Patchworkfamilie. Die „heilige Familie“ taugt auffallend gut als Rollenmodell für das heutige Verständnis der Familie als Verantwortungsgemeinschaft. Weit entfernt ist sie dagegen vom Vater-Mutter-Kind-Ideal des Biedermeier und der Romantik und auch von dessen ideologischen Fortschreibungen bis in politische Programme oder bischöfliche Verlautbarungen unserer Tage.
Machtkämpfe gehören zum weihnachtlichen Repertoire
Dies umso mehr, als Josef, Maria und ihr Neugeborenes unmittelbar zu Leidtragenden politischer Auseinandersetzungen werden. Die Deutung der Weihnachtsgeschichte als Flüchtlingsschicksal hat in Predigten unter dem Eindruck wachsenden Migrationsdrucks Konjunktur; angesichts des eskalierten Nahost-Konflikts gern ergänzt um die Betonung, dass Jesus das schutzbedürftige jüdische Kind jüdischer Eltern war.
Das sind sämtlich legitime Verlängerungen der erzählerischen Linien, die von den biblischen Autoren aus ursprünglich anderem Interesse gezogen wurden. Auch Herrschaftsansprüche und Machtkämpfe gehören fest zum weihnachtlichen Repertoire, sozusagen von Geburt an.
Und die Gewaltorgie des Kindermords von Bethlehem unterscheidet sich in nichts von den Strategien eines Wladimir Putin oder einer barbarischen Mördertruppe wie der Hamas. Physische Vernichtung, Krieg gegen einen Staat, Terror gegen ein Volk, die Völkergemeinschaft – immer setzen skrupellose Potentaten und fanatisierte Verbrecher dort an, wo Menschen am schwächsten, verletzlichsten und wehrlosesten sind.
Die drei Weisen entziehen sich dem Sog der Macht
Auch das reflektiert die biblische Weihnachtsgeschichte, und sie hat zudem eine herrschaftskritische Handreichung parat. Die Sterndeuter oder Weisen aus dem Morgenland, aus denen die Tradition die Kölner Heiligen Drei Könige gemacht hat, lassen sich auf ihrer Suche nach dem neugeborenen König der Juden nicht vom König Herodes mit seiner ganzen Heimtücke einwickeln. Der Herrscher heuchelt Interesse am Aufenthaltsort des Kinds, „dass auch ich komme und es anbe-te-he-he“, wie Johann Sebastian Bach es im „Weihnachtsoratorium“ mit einem musikalischen Kratzfuß vertont.
Tatsächlich will Herodes nur des vermeintlichen Konkurrenten habhaft werden und ihn umbringen. Die drei Weisen jedoch entziehen sich dem Sog der Macht, lassen Herodes links liegen und kehren auf einem anderen Weg heim in ihr Land.
Ihre Verehrung und ihre Geschenke bringen sie – als Gegentypus zu Machtmenschen wie Herodes - einem Kind, bei dem so gar nichts auf Königtum und (Gewalt-)Herrschaft hindeutet. Sie verlassen sich allein auf den Stern, der vor ihnen hergezogen und in Bethlehem stehengeblieben ist.
„Du fragst mich, Kind, was Liebe ist?“, heißt es in Heinrich Heines Gedicht „Unstern“, soeben von der nach ihm benannten Düsseldorfer Universität zum „liebsten Heine-Zitat 2023“ gekürt. Du fragst mich, Kind, was Liebe ist? „Ein Stern in einem Haufen Mist.“
Dass Menschen ein Licht aufgeht, wie es sich mit der Macht und mit den Mächtigen in Wahrheit verhält – auch das ist Weihnachten.





