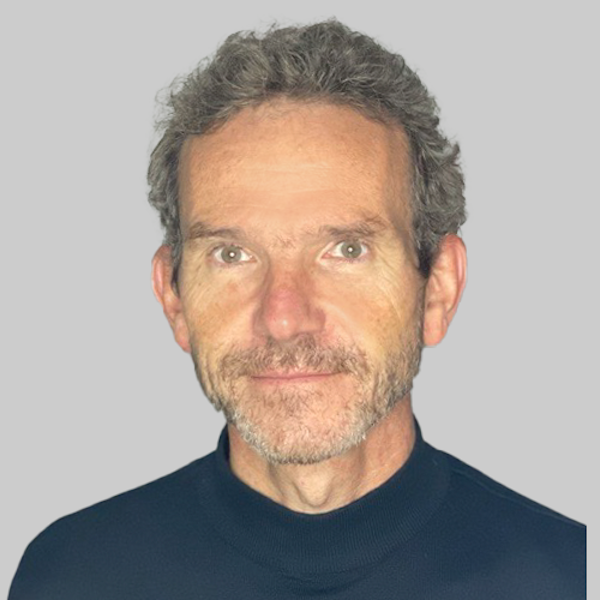Professor Hubert Wolf, Kirchenhistoriker an der Uni Münster, spricht im Interview über die Wahl Papst Leos XIV. und was diese für die katholische Kirche bedeutet.
Kirchenhistoriker Hubert Wolf„Leo XIV. wird insgesamt konservativ ticken“

Professor Dr. Hubert Wolf, Kirchenhistoriker an der Uni Münster
Copyright: Foto. Catrin Moritz
Ein Papst, der sich Leo nennt, und der zugleich der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri ist. Herr Professor Wolf, was setzt das bei Ihnen als Kirchenhistoriker in Gang?
Mit der Namenswahl gibt es jetzt 13 Anknüpfungspunkte in der Geschichte des Papsttums. Zwei große Vorgänger, Leo I. im 5. Jahrhundert und Leo XIII. vor gut 100 Jahren, stehen für eine klare Positionierung: politisch sehr agil, ambitioniert, auf der Höhe der Zeit, in theologischen Fragen konservativ und sehr bedacht auf den Machtanspruch der römischen Kirche. Leo der Große zum Beispiel war der erste, der den Führungsanspruch des Papsttums formuliert und zugleich gesagt hat: Im Römischen Reich geht alles drunter und drüber – der Einzige, der da für Ordnung und Frieden sorgen kann, ist der Bischof von Rom als Oberhaupt der katholischen Kirche.
Und Leo XIII.?
Mit der Sozialenzyklika „Rerum novarum“ war er der erste Papst, der sich den Problemen der Industrialisierung, der sozialen Frage, der Not der Arbeiterklasse und der Verarmung in der Gesellschaft gewidmet hat. Vielleicht ist genau diese Profilierung jetzt die Voraussetzung dafür gewesen, dass die große Mehrheit der Kardinäle sich hinter Robert Francis Prevost versammeln konnte.
Obwohl er Amerikaner ist?
Diese Wahl zeigt auch die gewaltigen tektonischen Verschiebungen in der Kirche. Noch vor 100 Jahren hat der US-Katholizismus aus Sicht Roms überhaupt keine Rolle gespielt. Der erste, der das Potenzial gecheckt hat, kirchlich und politisch, war ausgerechnet „der letzte Römer“ auf dem Papstthron, Papst Pius XII. Nach einer Amerikareise vor seiner Zeit als Papst hatte er verstanden, dass ohne die USA keine Weltpolitik mehr möglich ist. Das hat nach 1945 zur klaren Westbindung der Kirche beigetragen.
Alles zum Thema Römisch-katholische Kirche
- Kino und Kirche Papst Leo XIV. verrät seine Lieblingsfilme
- Für Kinder gedacht Bücherschrank „Anna“ wurde in Köln-Höhenhaus eingeweiht
- Arbeitsrecht Kein Job für Konfessionslose? Karlsruhe kippt Kirchen-Urteil
- Kitas betroffen So verändert sich die Struktur der katholischen Kirche in Euskirchen
- Stadtpatronefest Katholische Kirche ehrt Kölner Stadtpatrone St. Gereon und St. Ursula
- Schüsse auf Schulgottesdienst FBI geht von Inlandsterrorismus aus – Verdächtige war von Hass besessen
- Kircheneinbruch Diebe wollten Tabernakel aus einer Kirche in Hellenthal stehlen
Ist die Wahl Prevosts, der wiederholt auf Distanz zur amtierenden US-Regierung gegangen ist, auch ein Anti-Trump-Signal, oder denken die Kardinäle im Konklave nicht so politisch?
Ich glaube sehr wohl, dass politisches Kalkül hier eine Rolle gespielt hat. Den Diskussionen im Vorkonklave war das Bewusstsein für eine „Welt in der Krise“ zu entnehmen – die Gefahr eines neuen Weltkriegs eingeschlossen. Das war für die Kardinäle leitend. Finanzprobleme des Vatikans ja, aber eine Kurienreform – nein, die war vielleicht nicht so wichtig. Und es ist bemerkenswert, dass Leo XIV. seine erste Ansprache so prononciert als Friedensbotschaft formuliert hat – am 8. Mai, dem 80. Jahrestag des Weltkriegsendes. Das war schon stark.
Was ist mit Reformen in der Kirche?
Leo XIV. wird sicher keiner werden, der bei den in Deutschland vieldiskutierten Themen auf Veränderung dringt. Im Gegenteil. Frauen in den Ämtern, um nur ein Beispiel zu nennen, seien keine Lösung der Probleme, hat er gesagt, sondern schüfen neue. Ich glaube, Leo XIV. wird hier insgesamt eher konservativ ticken. So wie es die Wahl des Namens signalisiert.
Sie hatten von möglichen Anknüpfungspunkten bei insgesamt 13 Leo-Päpsten gesprochen. Welche kämen da noch infrage?
Als Deutscher denkt man da sofort an Leo X.
Den Kirchenfürsten aus dem Haus der Medici und großen Gegenspieler Martin Luthers? Nicht wirklich vorbildlich, oder?
Vielleicht in einer ironischen Verkehrung der Verhältnisse. Bedenken Sie: Martin Luther war Augustinermönch. Wie der jetzige Papst. Man könnte also sagen: Jetzt steht ein Augustiner auf der anderen Seite. Und wenn wir schon bei der deutschen Perspektive sind. Der schon genannte Papst Leo XIII. hat den Kulturkampf mit Bismarck gelöst bekommen. Da hat er eindeutig politisches Geschick bewiesen.
Wie sehen Sie den Anschluss an seinen direkten Vorgänger, Papst Franziskus? Dessen Programmwort, die „Synodalität“ der Kirche, hat Leo XIV. gleich in seiner ersten Ansprache aufgegriffen.
Ja, und der Papst hat dabei auch ein Wort des heiligen Augustinus zitiert: Mit euch bin ich Christ, für euch bin ich Bischof.
Die Betonung der Gemeinsamkeit mit den Gläubigen?
Einerseits. Andererseits aber auch die Markierung eines Gegenübers: Ich bin für euch der Bischof, lateinisch „Episcopus“ – der Aufseher.
Es ist jetzt das zweite Mal hintereinander, dass ein Ordensmann zum Papst gewählt wird. Franziskus war Jesuit, Leo XIV. ist Augustiner. Finden Sie das bemerkenswert?
Ich hoffe, dass das nicht die Regel wird. Beim nächsten Mal spätestens würde ich unruhig werden.
Warum?
Auch unter den Bischöfen sind immer mehr Ordensleute. So nach dem Motto: Wenn wir im Weltklerus keine geeigneten Kandidaten finden, dann holen wir sie aus dem Kloster. In der orthodoxen Kirche ist das die Regel, weil da die meisten Priester verheiratet sind, was sie als Bischöfe nicht sein dürfen. Ich sehe das skeptisch, weil das Bischofsamt durch die Wahl von Ordensleuten in unpassender Weise geistlich aufgeladen oder überformt wird. Mönche sind von ihrem Charisma nicht für kirchenleitende Funktionen bestimmt. Im Gegenteil: Sie stehen außerhalb des Systems – und traditionell oft auch in einem Gegenüber. Dieses kritische Potenzial wird verwässert, wenn Ordensmänner mehr und mehr zu Hierarchen werden.

Der Theologe und Preisträger Hubert Wolf spricht bei der Verleihung des Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa im Staatstheater Darmstadt.
Copyright: Foto: Helmut Fricke/dpa
Nach dem ganzen Hype um Konklave, weißen Rauch und Habemus papam – wird das Amt nicht vollkommen überfrachtet mit Erwartungen? Was kann der Papst beispielsweise politisch ausrichten? Er hat nun mal – mit Stalin gesprochen – keine Divisionen.
Beginnend im 19. Jahrhundert, ist das Papsttum zu einer charismatischen Herrschaft geworden. Das heißt: Es kommt erstmal nicht darauf an, was der Papst kann, sondern darauf, was wir auf ihn projizieren. Das Papsttum ist die ideale Projektionsfläche. Natürlich hat der Papst keine politische Macht im strengen Sinn. Sehr wohl aber hat er symbolisches Kapital, moralische Autorität als Sprecher für 1,4 Milliarden Katholiken. Damit sind wir aber beim derzeit neuralgischen Punkt: Durch die nicht adäquate Aufarbeitung des Missbrauchsskandals ist die moralische Autorität der Kirche und auch des Papsttums massiv angeknackst.
Wie kann sich daran wieder etwas ändern?
Als Historiker fordere ich seit langem, alle römischen Quellen seit 1945 zugänglich zu machen, um Transparenz über den Umgang des Vatikans mit Missbrauchsfällen zu schaffen. Nur Offenheit kann wieder Glaubwürdigkeit schaffen. Ohne Glaubwürdigkeit kann man weder den Glauben verkünden noch in politischen Fragen wirkungsvoll die Stimme erheben.
Genau das wäre doch die Transparenz und das, was man bräuchte, um Glaubwürdigkeit wiederherzustellen.
Was glauben Sie, wie viel „Beinfreiheit“ hat der neue Papst als Teil des Systems Kirche?
Er startet auf jeden Fall mit viel Vorschusslorbeer – auch dank der genialen Inszenierung rund um die Papstwahl. Jetzt kommt es darauf an, dass er sich nicht wieder mit allzu spontanen Äußerungen in Selbstwidersprüche verstrickt, wie das bei Franziskus der Fall war. Also: Wo stehen wir eigentlich im Ukraine-Krieg? Wo stehen wir in der Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hamas? Wo steht die Kirche in Bezug auf die Weltwirtschaftsordnung? Und innerkirchlich: Wenn er als Papst eine Vorstellung davon hat, was sich in der Kirche ändern soll, dann muss er es auch rechtlich regeln. Das hat Franziskus überhaupt nicht getan.
Woran denken Sie zum Beispiel?
Franziskus hat über Homosexuelle gesagt: Wer bin ich, sie zu verurteilen? Richtig so. Aber dann muss der Papst als oberster Gesetzgeber der Kirche daraus auch Konsequenzen ziehen und bestimmen, dass Homosexualität als eine natürliche Veranlagung des Menschen von der Kirche nicht mehr als Sünde bewertet wird.
Glauben Sie etwa, dass das passieren könnte? Sie sagten doch eben, Sie hielten Leo XIV. theologisch für eher konservativ.
Er hat als Kardinal gesagt, er könne die afrikanischen Bischöfe verstehen, die gegen eine Segnung homosexueller Paare Sturm gelaufen sind. Jetzt als Papst muss er in seiner Rolle umso mehr als Bewahrer der Einheit fungieren. Aber ich bin mal gespannt. Der Papst heißt ja auch „Pontifex“, Brückenbauer. Das hieße doch, unterschiedliche Verwirklichungen des Katholischen in der Vielfalt der Kulturen weltweit zu ermöglichen.
Das Interview führte Joachim Frank