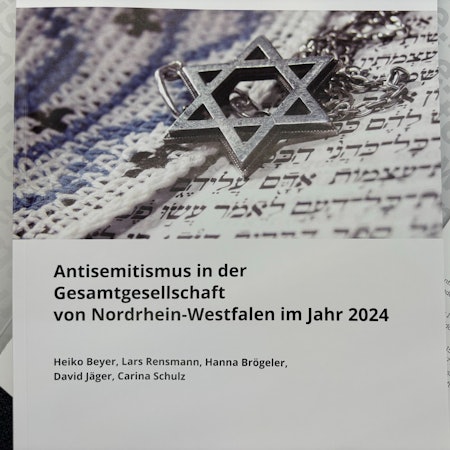Seit dem Angriff der Hamas auf Israel nehmen antisemitische Übergriffe in Deutschland zu, auch in Köln. Ein Jahr später spricht Bettina Levy von der Synagogen-Gemeinde über die Auswirkungen.
Jüdische Gemeinde in Köln„Wir bekommen Drohmails mit offenem Absender. Das ist neu“

Bettina Levy, Vorstandsmitglied der Synagogen-Gemeinde Köln, im Gebetshaus in der Roonstraße.
Copyright: Alexander Schwaiger
Vor der Synagoge in der Roonstraße liegt ein Blumenmeer. Und vor dem Blumenmeer steht ein Polizeiauto, das den Eingang rund um die Uhr bewacht. Auf die Mauer, flankiert von Topfpflanzen und Vasen, hat jemand ein Kuscheltier gelegt. Über allem weht an der Fassade ein riesiges Banner mit der Forderung, die Hamas-Geiseln zurückzubringen, zurück nach Hause: Bring them home.
Als sie vor ein paar Wochen zur Synagoge kam, wunderte sich Bettina Levy über die noch größere Menge an frischen Blumen. Ein passender Gedenk- und Feiertag fiel ihr zunächst nicht ein. Dann erinnerte sie sich an Ariel Bibas. Der israelische Junge, den die Hamas vor einem Jahr nach Gaza verschleppte, hatte Geburtstag. Ariel ist nun fünf Jahre alt.
„Das Zusammenhaltsgefühl in unserer Gemeinde gibt uns unfassbar viel Kraft“, sagt Bettina Levy. Sie ist Vorstandsmitglied der Synagogen-Gemeinde Köln und sitzt zum Gespräch am Tischende in der Bibliothek neben dem Gebetsraum der Synagoge. In den Regalreihen an der Wand türmen sich Bücher, auf einem Teller steht der Honigkuchen, der zu Rosch ha-Schana, dem Neujahrsfest, traditionell gegessen wird. Auch auf Levys T-Shirt steht der Schriftzug „Bring them home“.
Alles zum Thema Herbert Reul
- Reichsbürger Terrorverdächtiger aus Dortmund war seit 2019 auffällig
- Einsatz auch in Köln Mehr als 50 Durchsuchungen wegen Islamismus im Netz
- „Alte Männer in grauen Anzügen“ Colonia Kochkunstverein ehrt Sanna Marin in Abwesenheit
- Gutachter geben grünes Licht Herbert Reul kann NRW-Polizei landesweit mit Tasern ausrüsten
- Vorwürfe gegen Innenminister Herbert Reul (CDU) Grußwort war wichtiger als Plenarsitzung
- Pilotprojekt mit Polizei Wie rau ist der Ton auf den Schulhöfen? – Kölner Schulleiter berichten
- NRW-Landtag verabschiedet Gesetz Staat kann künftig SMS von Verdächtigen mitlesen

Zum Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel hat die Polizei NRW erhöhte Alarmbereitschaft, auch für die Synagoge an der Roonstraße in Köln.
Copyright: Alexander Schwaiger
Der 7. Oktober durchdringt hier alles. Auch das Brauchtum. Rosch ha-Schana wurde bis Freitagabend gefeiert, am 12. Oktober begehen Juden auf der ganzen Welt Jom Kippur, den Versöhnungstag. Und am Montag, wenn sich der Angriff der Hamas auf Israel zum ersten Mal jährt, trauert die jüdische Gemeinde an einem neuen Jahrestag.
Seit dem 7. Oktober wird Bettina Levy von fremden Menschen ungefragt auf das Vorgehen der israelischen Armee in Gaza angesprochen, wenn sie sich als Jüdin zu erkennen gibt. Sie versteckt sich nicht. Das Angebot, das Interview anonym zu führen, hatte sie energisch ausgeschlagen. Levy spricht selbstbewusst und entschlossen – sie will Gesicht zeigen. Seit dem 7. Oktober umso mehr.
„Israel bedeutet, nichts Besonderes zu sein“
Die erste Nachricht erreichte Levy schon Morgenstunden. Sie war von ihren Eltern, eigentlich leben sie in Köln, am 7. Oktober waren sie in Tel Aviv, als der Raketenalarm losging. Den Rest des Tages starrte Levy wie die meisten Gemeindemitglieder auf ihr Handy, telefonierte, wartete auf Anrufe von Angehörigen und Freunden, sah die Bilder aus Neukölln, wo Menschen feierten und Süßigkeiten verteilten und schaute Videos, in denen die Hamas Zivilisten ermordete.
Macht niemanden die Tür auf, schrieb Levy ihrer Familie und ihren Freunden in Israel. „Dieses Gefühl der Ohnmacht und Fassungslosigkeit ist unbeschreiblich.“
Einmal war Bettina Levy seit dem 7. Oktober wieder in Israel. Das Land hat sich verändert, fand sie, auch abseits der Bombenalarme. „Die Menschen bemühen sich, ihrem Alltag nachzugehen. Aber sie sind nicht mehr unbeschwert.“ Israel ist ein kleines Land. Viele kennen Menschen, die ermordet wurden. Andere sorgen sich um Familienmitglieder, die in der Armee kämpften, fürchten eine Ausweitung der Angriffe, bangen um die Geiseln. Auch aus der Synagogen-Gemeinde Köln wurden junge Männer eingezogen.
Israel, sagt Levy und lächelt, bedeutet für sie eine emotionale Heimat. Das Land ist eine Art Versicherung: Nirgendwo sonst fühlt sie sich als Jüdin so sicher. „Israel ist, nichts Besonderes zu sein. In Deutschland werde ich gefragt: Bist du Jüdin oder Deutsche? Als sei das eine Entweder-oder-Frage, ich bin jüdisch und ich bin Kölnerin. In Tel Aviv werde ich sowas nicht gefragt.“
Studie: Jeder Vierte in NRW zeigt antisemitische Einstellungen
Ende September stellten NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) und die Antisemitismusbeauftragte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger in Düsseldorf den neuen Antisemitismusbericht vor. Das Ergebnis: Bis zu 24 Prozent der Befragten glauben an eine „jüdische Weltverschwörung“, fast die Hälfte will einen Schlussstrich unter die NS-Geschichte ziehen, 19 Prozent stimmten einer Relativierung oder Leugnung des Holocaust zu. Ein Viertel glaubt, dass der Zentralrat der Juden Unfrieden in Deutschland schürt und abgeschafft werden müsste. Der Aussage „Was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben“, stimmten zehn Prozent der Befragten zu.
Bettina Levy fragt, ob sie etwas vorlesen dürfe. Dann öffnet sie ein Dokument auf ihrem Handy mit Notizen. Es sind Gedanken, die sie seit dem 7. Oktober besonders beschäftigen. „Sind wir als Juden auch hier in Deutschland frei? Ist diese Selbstverständlichkeit nicht eine Theorie geblieben?“, liest sie. „Ich gebe mich als Jüdin öffentlich zu erkennen. Muss ich mir Gedanken machen, ob ich meinen Davidstern ausziehen sollte? Wohlwollende Freunde fragen mich: Kannst du hier noch leben? Jüdische Freunde fragen mich: Wo gehen wir hin?“
Es sind die falschen Fragen, die wohlwollende Freunde stellen, findet Levy. Stattdessen wünscht sie sich Gespräche darüber, was man als Gesellschaft gemeinsam ändern muss, damit jüdische Menschen in Deutschland sicher leben können. „Und nicht, dass ich gefragt werde, ob ich weggehe.“ Ihre Kette mit dem hebräischen Anhänger wird sie nicht ablegen. Das, betont Levy, sei jedoch eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen müsse.

Antisemitische Übergriffe nehmen auch in Köln seit dem 7. Oktober extrem zu, sagt Bettina Levy, hier im Gespräch in der Synagoge in der Roonstraße.
Copyright: Alexander Schwaiger
Als Bettina Levy wenige Minuten vor dem Gespräch in den Gängen des Gebetsraums auf die Kamera des Fotografen zugeht, lehnt sich ein Mitarbeiter der Gemeinde an eine der Sitzreihen. Vor dem Thoraschrein thront eine Menora, durch die bunten Fenster fällt Sonnenlicht. Vor zwei Stunden ging er auf dem Weg zur Synagoge am Neumarkt vorbei, erzählt der Mitarbeiter Levy verärgert. Dort brüllte eine Frau herum, offenbar berauscht von Drogen. „Drecksjuden raus!“, schrie sie. Niemand reagierte. Alle seien weitergelaufen.
„Manche Kinder wechselten wegen Anfeindungen die Schule“
Antisemitische Übergriffe nehmen auch in Köln seit dem 7. Oktober extrem zu, sagt Bettina Levy. „Das fängt bei Schmierereien an bis zu Bedrohungen. Die müssen nicht immer explizit sein, aber sie werden immer expliziter. Die Politik des Staates Israel wird als Steilvorlage für antisemitische Äußerungen genutzt.“ In ihrer Gemeinde erzählen Mitglieder von Ausgrenzungen ihrer Kinder in den Schulen, von Beschimpfungen und Beschuldigungen. „Manche Kinder wechselten deshalb die Schule“, sagt sie. „Eine Familie hat sogar die Stadt verlassen.“
Die Hemmschwelle ist gesunken, sagt Levy. Einen hundertprozentigen Schutz gab es zwar nie, doch die Bedrohungslage verschärft sich, ebenso der Ton im persönlichen Miteinander. „Wir bekommen Drohmails mit offenem Absender. Das ist neu.“ An all das kann und will sie sich nicht gewöhnen. „Wenn jüdische Menschen in Deutschland bedroht werden, dann heißt das auch ganz einfach: Ein Mensch in Deutschland wird bedroht. Es ist unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dagegen vorzugehen.“
„Die Unbeschwertheit, einfach in ein nicht bewachtes, jüdisch kenntliches Gebäude zu gehen, kennen unsere Kinder nicht“
Jüdisches Leben ist in der Kölner Stadtgesellschaft sichtbar und fest verankert. Die Stadtbahn „Schalömchen“ fährt über die Linien 1, 7, 12 und 15, die Kölschen Kippa-Köpp laufen im Rosenmontagszug mit. Kölner Juden können ihre Kinder in einen jüdischen Kindergarten und in eine jüdische Grundschule schicken, sie gehen ins rituelle Tauchbad, sie können täglich alle Gottesdienste besuchen und werden auf dem jüdischen Friedhof beerdigt.
Und jüdische Kinder in Köln wachsen mit der Selbstverständlichkeit auf, dass vor ihrem Kindergarten, der Grundschule und der Synagoge ein Polizeiauto steht. Nicht, weil die Gemeinde dies wünscht, sondern weil die Polizei es für notwendig erachtet. „Die Unbeschwertheit, einfach in ein nicht bewachtes, jüdisch kenntliches Gebäude zu gehen, kennen unsere Kinder nicht“, sagt Levy.
Was macht die ständige Bewachung von jüdischen Einrichtungen mit einem erwachsenen Mitglied der Gemeinde? Bettina Levy schweigt lange, blickt auf das lange Bücherregal. „Ich frage mich, ob ein Punkt kommen kann, an dem die Bewachung nicht mehr ausreicht.“
An keinem anderen Tag seit dem Holocaust wurden mehr Juden ermordet als am 7. Oktober. Die Gemeinde wird den Jahrestag am Montag mit einem Gottesdienst begehen. Es ist das Ursprünglichste, wie man der Trauer begegnen kann, sagt Levy. „Wir werden für die Geiseln und die gesunde Rückkehr der Soldaten aus dem Krieg beten.“ Der Jahrestag liegt nur vier Tage vor Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag.
Vor der Eingangstür der Synagoge wird an beiden Tagen wieder ein Polizeiauto stehen, womöglich sogar mehr als nur eines. Innenminister Reul veranlasste, die polizeilichen Maßnahmen zum Schutz jüdischer Einrichtung am 7. Oktober und den anstehenden Feiertagen zu verstärken.